Grundlinien einer Rassenhygiene
Ploetz, Alfred, Berlin: Fischer, 1895.

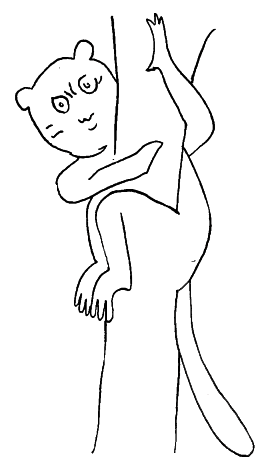
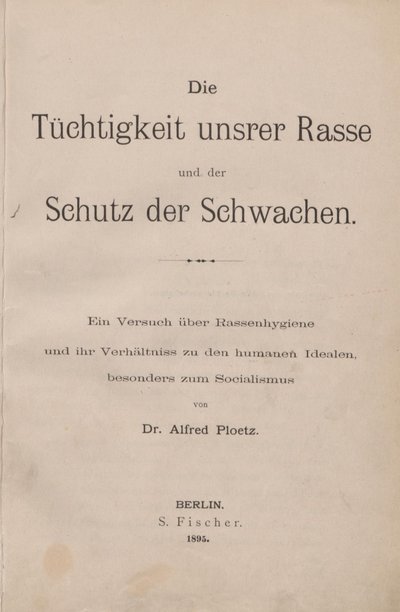
Grundlinien einer Rassenhygiene
Ploetz, Alfred, Berlin: Fischer, 1895.

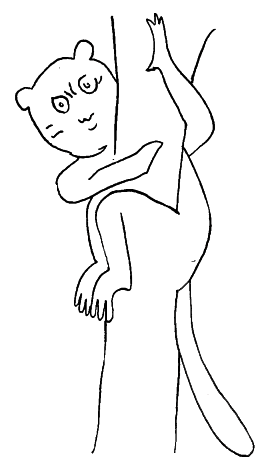
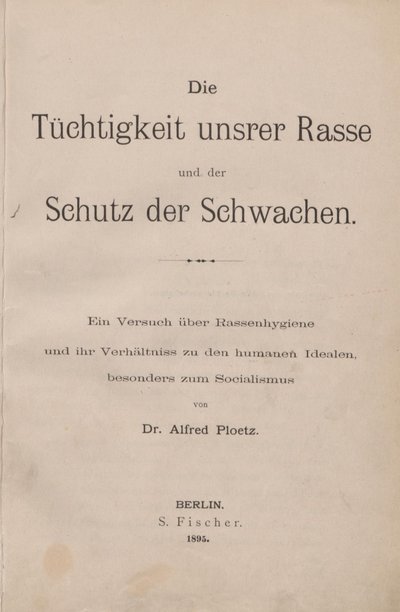
アルフレート・プレッツ『人種衛生学の基礎』
書誌情報
Grundlinien einer Rassenhygiene Ploetz Alfred Geyken Alexander Haaf Susanne Jurish Bryan Boenig Matthias Thomas Christian Wiegand Frank Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) Langfristige Bereitstellung der DTA-Ausgabe Vollständige digitalisierte Ausgabe. 265 58227 10553 428597 dta@bbaw.de Deutsches Textarchiv Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (BBAW) Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin Germany Berlin 2021-02-18T14:38:14Z Distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. https://www.deutschestextarchiv.de/ploetz_rassenhygiene_1895 https://www.deutschestextarchiv.de/book/download_xml/ploetz_rassenhygiene_1895 https://www.deutschestextarchiv.de/book/download_html/ploetz_rassenhygiene_1895 https://www.deutschestextarchiv.de/book/download_text/ploetz_rassenhygiene_1895 ploetz_rassenhygiene_1895 16367 urn:nbn:de:kobv:b4-200905194617 Ploetz, Alfred: Grundlinien einer Rassenhygiene. Berlin: Fischer, 1895. Grundlinien einer Rassenhygiene Ploetz Alfred XI, VII, 240 S. Fischer Berlin 1895 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz SBB-PK, La 4618-1 http://stabikat.de/DB=1/SET=12/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=410141100 Antiqua Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert. font-family:sans-serif font-weight:bold color:blue display:block; text-align:center display:block; margin-left:2em; text-indent:0 display:block; margin-left:4em; text-indent:0 display:block; margin-left:6em; text-indent:0 border:1px dotted silver border:1px dotted silver letter-spacing:0.125em font-style:italic font-size:150% font-variant:small-caps font-size:larger color:red display:block; text-align:right text-decoration:line-through font-size:smaller vertical-align:sub; font-size:.7em vertical-align:super; font-size:.7em text-decoration:underline border-bottom:double 3px #000 (Früh-)
Neuhochdeutsch German
Fachtext Gesellschaftswissenschaften Wissenschaft Anthropologie core
ready china Die Tüchtigkeit unsrer Rasse und der Schutz der Schwachen.
Ein Versuch über Rassenhygiene und ihr Verhältniss zu den humanen
Idealen, besonders zum Socialismus von Dr. Alfred Ploetz. BERLIN. S.
Fischer. 1895. Aufwärts geht unser Weg, von der Art hinüber zur Ueber-
Art. Aber ein Grauen ist uns der entartende Sinn, welcher spricht:
„Alles für mich!“ Friedrich Nietzsche. Grundlinien einer Rassen-Hygiene
von Dr. Alfred Ploetz. I. THEIL: Die Tüchtigkeit unsrer Rasse und der
Schutz der Schwachen. BERLIN. S. Fischer. 1895. Die Tüchtigkeit unsrer
Rasse und der Schutz der Schwachen. Ein Versuch über Rassenhygiene und
ihr Verhältniss zu den humanen Idealen, besonders zum Socialismus von
Dr. Alfred Ploetz. BERLIN. S. Fischer. 1895. Alle Rechte vorbehalten.
Vorwort. Die vorliegende Arbeit ist aus den Bedürfnissen des Arztes
entsprungen, aus zwiespältigen Gedanken und Empfindungen, wie sie sich
wohl auch jedem anderen Aeskulapjünger und hilfsbereiten Menschen
aufgedrängt haben, der einerseits die Schwächen und Krankheiten nicht
nur in ihrer directen nosologischen Verursachung, sondern auch in ihren
Abhängigkeiten von angeborenen Anlagen und von socialen und
wirthschaftlichen Zuständen verstehen gelernt hat, und der andrerseits
mit Sorge auf die Gefahren blickt, mit denen der wachsende Schutz der
Schwachen die Tüchtigkeit unserer Rasse bedroht. Das Buch wendet sich
nicht nur an den Wissenschaftler, sondern hauptsächlich an den socialen
Practiker. Die reinen Wissenschaftler vergessen zu oft, dass die
Mensch- heit nicht nur erkennen, sondern die Erkenntniss schliess- lich
als Mittel zur Befriedigung ihrer Wünsche, zum Handeln nach ihren
Motiven, benutzen will. Sie stehen deshalb oft kaltherzig und
verständnissarm den allge- Vorwort. meinsten Culturbestrebungen
gegenüber, die zu begreifen Kopf und Herz erfordert. Leider hat die
Unmöglichkeit, bei unserem so weit- tragenden Gegenstand die Arbeit zu
theilen, den Nachtheil aller mangelhaften Arbeitstheilung im Gefolge:
die Un- gleichmässigkeit im Aufbau des Gebotenen. Dazu kommt noch als
erschwerendes Moment die grosse Reihe von Hülfswissenschaften, die
herangezogen werden müssen. Es konnte daher auch nur das lebhafte
Verlangen nach einem einheitlichen Princip des ärztlichen Handelns
mich, als practischen Arzt, dazu bewegen, ein so um- fassendes Problem
wie die Hebung unserer Rasse in nähere Betrachtung zu ziehen. Die
Geringfügigkeit unserer bisherigen Kenntnisse darüber hat bedingt, dass
ich noch viele Fragen stellen musste, wo ich gern Antworten ge- geben
hätte, hat mich aber auch bei der Wichtigkeit des Gegenstandes nur um
so mehr veranlasst, Probleme systematisch aufzustellen, um wenigstens
einen Theil des mächtigen Stroms der modernen Forschung auf dieses
Gebiet hinzulenken. Ich bin mir also des Charakters meiner Arbeit als
eines Versuchs bewusst. Was ich damit bezwecke und fordere, ist nicht
nur die Interessirung weiterer Kreise für die gebrachten Probleme und
Thatsachen, sondern auch eine dauernde Zusammenfassung aller in
Betracht kommenden Wissenszweige zu einer ungetheilten, selbst-
ständigen Specialdisciplin der Rassenhygiene, die ihre eigenen Wege
wandelt. Vorwort. Die so nahe Berührung unseres Gegenstandes mit der
Socialpolitik hat es nothwendig gemacht, in dem be- kannten Streit
zwischen Socialismus und Darwinismus Stellung zu nehmen. Ich hoffe,
durch meine Ausführungen dazu beizutragen, dass der Streit von seinem
bisherigen Terrain abgedrängt und auf ein neues hingeleitet wird, wo er
erspriesslicher werden kann, nämlich auf das Ge- biet der Erforschung
und Beherrschung der Variation. Die Arbeit wird in zwei äusserlich von
einander unabhängigen Theilen, einem theoretischen und einem mehr
practischen, herausgegeben. Der erste Theil liegt hier vor, der zweite
soll im Herbst erscheinen. Berlin W., Charlottenstr. 59, im Februar
1895. Inhalt. Seite Einleitung 1 Rassenhygiene und Individualhygiene 1
Ihre Verschiedenheit 3 Nothwendigkeit einer besonderen Hygiene der
Rassen 4 Lykurgus 5 Darwinianer und Socialisten 8 Vervollkommnung 12
Hygiene des Individuums der Rassenhygiene unterzuordnen 13 1. Capitel.
Allgemeine Factoren der Erhaltung und Entwickelung 15 Der
Gesammtprocess 15 Darwin — Wallace 16 Vererbung 20 Keimplasma.
Vererbung erworbener Eigenschaften 22 Praeformation und Epigenese 25
Variation 31 Ursachen 32 Keimauslese 34 Befruchtung 36 Spätere
Wirkungen 36 Grenzen und Häufigkeit der Variirens 38 Vererbung von
Variationen 39 Kampf um’s Dasein und natürliche Auslese 40
Vermehrungstendenz der Wesen 41 Regulationen im Organismus.
Constitutionskraft 43 Extral- und Socialwirkungen 43 Nonselectorische
und selectorische Factoren 45 Seite Starke und schwache Varianten 47
Kampf der Societäten 49 Bedeutung der drei Entwickelungsfactoren 50 2.
Capitel. Die Erhaltung und Vermehrung der Zahl 54 Geburten- und
Sterbeziffer 54 Höchste und niedrigste 55 Geburtenüberschuss 57
Schädlichkeiten und Constitutionskraft 60 Contraselection: Kriege,
präventiver Geschlechtsverkehr, künstliche Fehlgeburt 61 Sinkende
Rassen. Franzosen 65 Geburtenprävention als Ursache 68 Möglichkeiten
der Abhülfe 72 Yankees 75 Amerikanische Juden 77 Aufsteigende Rassen.
Westarier, Europäische Juden 78 Germanen. Engländer, Deutsche und
Skandinavier 81 Europäische Sprachen 85 Deutsche im Reich, in der
Schweiz, in Oesterreich-Ungarn und anderen Nachbarländern 86 3.
Capitel. Die Vervollkommnung des Typus 91 Wesen der Vervollkommnung die
Verstärkung und höhere Differenzirung der Regulationskraft. Gorilla,
Neger, Weisser 91 Gehirnentwickelung 95 Vollkommnere und stärkere
Convariante 98 Rückschritt der Organisation. Panmixie 98 Panmixie beim
Menschen? 104 Schönheit, Altruismus, hohes Alter 107 Rassenhygienische
Forderungen für Vervollkommnung des Typus und Vermehrung der Zahl 114
Hat sich der menschliche Typ in den letzten Jahrtausenden
vervollkommnet? 117 Schreitet er gegenwärtig noch fort? 127 Die besten
Rassen 130 Westarier 130 Juden 137 4. Capitel. Der ideale und der
heutige Rassenprocess 143 Der ideale Rassenprocess 143 Erzeugung guter
Devarianten, Natürliche und künstliche Zuchtwahl 144 Seite Der heutige
Rassenprocess 148 Variation. Erzeugung schlechter Devarianten durch
mangel- hafte sexuelle Zuchtwahl, Jugendlichkeit der Eltern, giftige
Genussmittel 148 Auslese 150 Künstliche Ernährung von Säuglingen.
Ungleiche Erziehung 150 Wirthschaftliche Ausjätung. Armuth ist
selectorisch und nonselectorisch 151 Wirkungen der Armuth und des
Wohlstandes auf Gesundheits- zustand, Ehe- und Geburtenziffer 156
Ersetzt sich die Bevölkerung mehr aus den Armen oder den Wohlhabenden?
181 Contraselection, grosse Städte 183 Nonselectorische
Schädlichkeiten, Unfälle, Trinksitten 188 Kurze Gegenüberstellung der
beiden Processe 193 5. Capitel. Der Conflict zwischen Rassen- und
Individual-Hygiene und seine Lösung 196 Die nonselectorischen
socialpolitischen Systeme 196 Ihre elementaren Forderungen: der
angepassten Summen der Bevölkerung und der Productionsmittel, des
gleichen Nutzrechtes der Productionsmittel und der Versicherung gegen
Arbeitsunfähigkeit 199 Die Beziehungen dieser drei Postulate zur
Erhaltung und Fort- pflanzung der Individuen. Socialismus und
Malthusianismus 202 Conflict mit den Forderungen der Rassenhygiene 207
Angriffe bedeutender Darwinianer auf die nonselectorischen Systeme 208
Deren Vertheidiger und ihre Versuche zur Lösung des Conflicts 212
Wallace’s Lösung durch Verstärkung der sexuellen Auslese 217 Lösung
durch Beherrschung der Variabilität 224 Beeinflussung und künstliche
Auslese der Keime 230 Einwürfe 230 Die modifizirten Rassenforderungen
236 Nothwendigkeit, schon heute Kenntnisse zu verbreiten, die die
Erzeugung tüchtiger Nachkommen betreffen 236 Der Socialismus vom
rassenhygienischen Standpunkt 237 Berichtigung. Auf S. 93, Zeile 16 von
oben, füge ein: Die Einwanderung fremder Weisser war nur gering.
Einleitung. Rassenhygiene und Individualhygiene. Ihre Verschiedenheit.
Noth- wendigkeit einer besonderen Hygiene der Rassen. — Lykurgus.
Darwinianer und Socialisten. — Vervollkommnung. Hygiene des Individuums
der Rassenhygiene unterzuordnen. Völker tauchen auf und versinken
wieder, einige in’s Nichts, wie die Gothen, andere in unbedeutende
Mittel- mässigkeit, wie die Griechen. Es waren nicht immer die
schlechtesten, die so herabsanken. Gothen wie Griechen hatten viele
hervorragende Eigenschaften, sie waren Völker von heldenhafter
Gesinnung, und doch schwanden oder welkten sie hin unter Einwirkungen,
denen sie nicht ganz angepasst waren. Auch in der Gegenwart, in unserer
nächsten Nachbarschaft sehen wir ein Volk räthselhaft kranken. Die
Franzosen sind als Rasse zum Stillstand gekommen, ja schreiten zurück
trotz der materiell günstigen Bedingungen, unter denen sie leben, und
nur der Nach- wuchs eingewanderter Fremder ersetzt ihren Namen, aber
nicht ihre Rasse. Die Völker und Rassen sind eben organische Lebe-
wesen, bestimmt wie Thiere und Pflanzen durch ihre Einzel-
Constituenten, hier Zellen, dort Menschen, für die ihre Umgebung ein
Complex günstiger oder ungünstiger Be- dingungen ist. Und grade wie wir
für den Menschen durch Zusammen- fassen der günstigen Bedingungen eine
Hygiene geschaffen haben, die, im Ende basirend auf dem Leben seiner
Zellen, ihn lehrt, wie er möglichst lange die Gesundheit erhält 1 und
den Tod hinausschiebt, so ist es an der Zeit, basirend auf den
Lebensfunctionen der Menschen, die Grundlegung einer Hygiene der Rassen
und der ganzen menschlichen Gattung zu versuchen, die lehrt, wie eine
organische Ge- sammtheit von Menschen sich möglichst lebenskräftig
erhält und ihr Vergehen möglichst lange hinausschiebt. Das Wort Rasse
wird beim Menschen in verschiedenem Sinne gebraucht. So spricht man von
der menschlichen Rasse schlechthin und meint damit die Gesammtheit des
Menschengeschlechts. Ferner braucht man das Wort für die nächsten
Unterabtheilungen, in die man die Species Homo sapiens getrennt hat;
man spricht z. B. von der kaukasischen und der mongolischen Rasse. Aber
auch für die noch weiter gehenden Zerspaltungen braucht man das- selbe
Wort, so für die Germanen, Romanen u. s. w. Am wenigsten am Platze ist
es zur Bezeichnung heutiger Rassen- gemische, die nur durch gemeinsame
Sprache oder poli- tische Verwaltung als Einheiten erscheinen, so bei
der französischen, britischen Rasse etc. Abgesehen von einer kurzen
Besprechung der Rassen in naturwissenschaftlichem Sinne mit Bezug auf
ihren Cultur- werth werde ich das Wort einfach als Bezeichnung einer
durch Generationen lebenden Gesammtheit von Menschen in Hinblick auf
ihre körperlichen und geistigen Eigen- schaften brauchen. Dies kann um
so eher geschehen, als sämmtliche Ausführungen bis auf die im vorigen
Satz er- wähnte, grade so gut Geltung haben für kleine wie für grosse
Gemeinschaften von Menschen, für Rassen im zoo- logischen Sinne grade
so gut wie für Mischrassen und moderne Staaten. Das Fehlen von
umfangreichen Angaben über die Vitalstatistik eigentlicher Rassen im
engeren Sinne zwingt zum Erläutern vieler Punkte an dem Material po-
litisch abgegrenzter Complexe Auf den ersten Blick könnte man denken,
dass die Bedingungen des Gedeihens einer Rasse einfach dadurch gegeben
wären, dass man für das Gedeihen jedes einzelnen Mitgliedes derselben
sorgt, dass also Rassenhygiene und die gewöhnliche Hygiene des
Individuums eines und das- selbe wären.Zur Nomenclatur: Die Hygiene des
Individuums zerfällt in die private und in die öffentliche oder soziale
Hygiene. Die private Hygiene hat es mit den Gesundheitsbedingungen zu
thun, die jeder selbst un- mittelbar beherrscht oder die wenigstens
innerhalb der Familie zur Beach- tung kommen. Die öffentliche oder
soziale Hygiene umfasst alle die Bedingungen für den Gesundheitszustand
der Einzelnen, die von der Ge- sellschaft oder dem Staat ausgehen.
Soziale Hygiene und Rassenhygiene sind also nicht zu verwechseln.
Soziale Hygiene hat als directes Ziel immer noch das Wohl des
Einzelnen, Rassenhygiene dagegen das Wohl einer zeitlich dauernden
Gesammtheit als solcher. Das gilt aber keineswegs so ohne Weiteres. Es
giebt hervorragende Forscher, die sogar einen tiefen Gegensatz zwischen
der modernen Hygiene und dem Rassenwohl er- kennen wollen. Wallace, der
Mitbegründer der Selections- theorie, constatirt dies in folgenden
Worten: „Bisher hat man allgemein angenommen, dass wohlthätige
Einflüsse, wie die der Bildung, Hygiene, sozialen Verfeinerung, eine
po- sitive Wirkung hätten und an und für sich zu einer stetigen Hebung
aller civilisirten Rassen führen müssten. Diese Anschauung ruhte auf
dem Glauben, dass jede während der Lebenszeit erfolgte Hebung der
Tüchtigkeit des Ein- zelnen sich auf seine Nachkommenschaft übertrage,
und dass es so möglich sein werde, auch ohne irgend welche Auslese der
besseren oder Ausscheidung der niedrigeren Typen einen stetigen
Fortschritt in physischen, sittlichen und geistigen Eigenschaften zu
schaffen. Aber in den letzten Jahren ist diese Meinung durch gewichtige
Zweifel erschüttert worden, namentlich durch die bedeutsamen
Forschungen Galton’s und Weismann’s über die Grundursachen der
Vererbung.“Wallace, Menschliche Auslese. Zukunft von Harden No. 93. S.
10. Schallmeyer drückt sich noch directer so aus: „dass die denkbar
grössten Fortschritte, welche die 1* therapeutische Medizin der Zukunft
etwa machen könnte, wohl den jeweiligen kranken Individuen, nicht aber
der mensch- lichen Gattung zum Heile gereichen werden.“W. Schallmeyer.
Ueber die drohende körperliche Entartung der Kulturmenschheit.
Berlin-Neuwied 1891. S. 7. Citirt bei Ammon. Aehnlich äussert sich der
Anthropologe Ammon in seinem inter- essanten Werk über die menschliche
Auslese: „Die Beseitigung — der in sittlicher Beziehung am
urgünstigsten ausgestat- teten Individuen durch die Rechtspflege,
wirthschaftliches Elend etc. — ist eine Nothwendigkeit, wenn nicht die
Durchschnittshöhe der Menschheit sinken soll. Es verhält sich hier
ähnlich wie bei der Gesundheitspflege, wo die künstliche Erhaltung
schwächlicher Individuen den Durch- schnitt der Gesundheit
herabdrückt.“Otto Ammon. Die natürliche Auslese beim Menschen. Jena.
Gustav Fischer 1893. S. 281. Thatsächlich invol- virt das Verlangen der
meisten Darwinianer, der Kampf um’s Dasein innerhalb der menschlichen
Gesellschaft müsse er- halten bleiben, weil sie sonst entarten würde,
eine Ver- urtheilung der Hygiene, die Alle, die Starken und die
Schwachen, schützen möchte. Ich müsste zuviel citiren, um den
zahlreichen Aussprüchen der Darwinianer über diesen Punkt gerecht zu
werden. Nur die Worte Darwin’s selbst sollen eine Stelle finden: „Wie
jedes andere Thier ist auch der Mensch ohne Zweifel auf seinen
gegenwärtigen hohen Zustand durch einen Kampf um die Existenz als Folge
seiner rapiden Vervielfältigung gelangt, und wenn er noch höher
fortschreiten soll, so muss er einem heftigem Kampf ausgesetzt
bleiben.“ („It is to be feared, that he must remain subject to a severe
struggle“).Darwin, Charles. Die Abstammung des Menschen. Uebersetzt von
Carus. Stuttgart 1881. II. Bd. S. 379. Jedenfalls erhellt aus den
Aeusserungen dieser Männer, zu denen auch der mild gesinnte Darwin
gehört, dass die Anschauung, das Wohl unserer Rasse werde am besten
erreicht durch die Sanirung der Lebensbedingungen aller
Einzel-Individuen, durchaus nicht eine allgemein ange- nommene ist.
Daraus folgt die Nothwendigkeit, dem Begriff der Hygiene im
gewöhnlichen Sinne, der Individual-Hygiene, einen anderen Begriff
gegenüber zu stellen, den der Hygiene einer Gesammtheit von Menschen.
So könnte man von der Hygiene einer Nation, einer Rasse im engeren
Sinne oder der gesammten menschlichen Rasse reden. Im weiteren Verlaufe
des Buches werde ich stets, wenn nicht ausdrücklich anders bemerkt, das
Wort Rassenhygiene im: allgemeinen Sinne anwenden, entsprechend meinem
Gebrauch des Wortes Rasse. Dies schien mir um so eher gestattet, als,
wie ich glaube, die Hygiene der gesammten mensch- lichen Gattung
zusammenfällt mit derjenigen der arischen Rasse, die abgesehen von
einigen kleineren, wie der jüdischen, die höchstwahrscheinlich ohnehin
ihrer Mehrheit nach arisch ist, die Culturrasse par exellence
darstellt, die zu fördern gleichbedeutend mit der Förderung der
allgemeinen Mensch- heit ist. Ich weiss nicht, ob das Wort
Rassenhygiene schon ausgesprochen wurde oder nicht; sicher ist, dass
der da- rin enthaltene Begriff längst in vielen Köpfen lebte, und dass
er in den Geisteskämpfen unserer Tage eine grosse Rolle spielt. Als im
alten Sparta das Gesetz anordnete, dass die neugeborenen Kinder in
kaltes Bergwasser getaucht und die schwächlichsten unter ihnen auf den
unwirthlichen Höhen des Taygetos ausgesetzt würden; schadete es Ein-
zelnen, nützte aber bewusst der Gesammtheit. Derselbe Ge- danke leitete
Lykurg und die übrigen Mitarbeiter an der spar- tanischen Verfassung
auch bei der Ordnung noch mancher anderen menschlichen Beziehungen.
Nach Plutarch war Lykurg überhaupt ein sehr bewusster Rassenhygieniker,
der auch die Bedeutung der Zeugung für seine Absichten klar erkannte.
In seinen Biographien (Uebersetzung von Kaltwasser, Wien, 1805. Seite
181 u. ff.) berichtet Plutarch folgendes: „Bei der Erziehung, die er
als das grösste und wichtigste Geschäft eines Gesetzgebers betrachtete,
fing er ganz von vorn an und richtete sein Augenmerk zu allererst auf
die Ehen und die Erzeugung der Kinder … Zuerst suchte er die Körper der
Jungfrauen durch Laufen, Ringen und das Werfen der Wurfscheiben und
Spiesse abzuhärten, da- mit die in einem starken Körper erzeugte Frucht
kraftvoll aufkeimen und gedeihen könnte, sie selbst aber die zur Geburt
erforderlichen Kräfte erlangen und die Schmerzen leicht und ohne Gefahr
überstehen möchten. Um aber alle Weichlichkeit, Verzärtelung und andere
weibliche Eigenschaften auszurotten, gewöhnte er die Mädchen so gut wie
die Knaben, den feierlichen Aufzügen nackend beizuwohnen, und so an
gewissen Festen in Gegenwart und vor den Augen der Jünglinge zu tanzen
und zu singen … Uebrigens hatte diese Entblössung der Jungfrauen nichts
Schändliches, da immer Schamhaftigkeit dabei ob- waltete und alle
Lüsternheit verbannt war, sie wurde viel- mehr zu einer unschuldigen
Gewohnheit, erzeugte eine Art von Wetteifer in Absicht der guten
Leibesbeschaffen- heit und flösste auch dem weiblichen Geschlechte
edle, erhabene Gesinnungen ein … Die Verheirathung selbst geschah auf
die Art, das Jeder sich eine Jungfrau raubte, nicht aber eine kleine
oder unmannbare, sondern eine solche, die völlig erwachsen und zur Ehe
reif war. … Der Bräutigam schlich sich dann, nicht betrunken, nicht
durch Schwelgerei entkräftet, sondern bei völliger Nüchternheit, und
nachdem er wie immer mit seinen Tisch- genossen gespeist hatte,
heimlich zu ihr, löste ihr den Gürtel und trug sie aufs Bett. Wenn er
eine kurze Zeit mit ihr zugebracht hatte, ging er wieder sittsam weg,
um an dem gewöhnlichen Orte in Gesellschaft der anderen jungen Männer
zu schlafen. Ebenso hielt er es auch in der Folge; den Tag brachte er
unter seinen Kameraden hin, schlief des Nachts bei ihnen und seine
Braut besuchte er heimlich und mit der grössten Behutsamkeit. … Ein
solches Zusammenkommen diente nicht allein zur Uebung in der
Enthaltsamkeit und Mässigkeit, sondern sie beförderte auch die
Fruchtbarkeit und machte, dass sie sich immer mit neuer und verjüngter
Liebe umarmten. … Er (Ly- kurg) hielt es freilich für rathsam, dass der
Frechheit und Ausschweifung in der Ehe gesteuert würde, auf der ande-
ren Seite aber fand er es dem Staat zuträglich, wenn unter den würdigen
Männern eine Gemeinschaft der Kinder und deren Erzeugung stattfände,
und in so fern lachte er diejenigen aus, welche bei solchen Dingen
durchaus keine Theilnahme gestatten. … Es war also einem bejahrten
Manne, der eine junge Frau hatte, vergönnt, einen jungen wackeren Mann,
der ihm gefiel, und den er für tüchtig hielt, bei seiner Frau
einzuführen, und das von ihnen aus edlem Samen erzeugte Kind für das
seinige anzuerkennen. Auf der anderen Seite stand es auch einem recht-
schaffenen Manne frei, wenn er die Frau eines Anderen wegen ihrer
Fruchtbarkeit und Tugend schätzte, den Gatten derselben um die
Erlaubniss zu bitten, dass er ihr beiwohnen und gleichsam in einen
fruchtbaren Boden pflanzen und gute Kinder erzeugen dürfte. … Lykur-
gus glaubte, dass die Kinder … dem Staate gemein- schaftlich gehörten,
und in dieser Rücksicht, wollte er die Bürger nur von den Besten, nicht
aber von Jedem ohne Unterschied erzeugen lassen … Es hing nicht bloss
von dem Vater ab, ob er das geborene Kind aufziehen wollte, sondern er
musste es an einen ge- wissen Ort, Lesche genannt, tragen, wo die
Aeltesten der Zünfte versammelt waren. Diese besichtigten es genau, und
wenn es stark und wohlgebaut war, hiessen sie es ihn aufziehen, und
wiesen ihm eins von den 9000 Loosen an; war es hingegen schwach und
übelgestaltet, so liessen sie es gleich in ein tiefes Loch am Berge
Taygetos werfen, weil man glaubte, dass ein Mensch, der schon vom
Mutter- leibe an einen schwachen und gebrechlichen Körper hat. sowohl
sich selbst als dem Staate zur Last fallen müsste.“ Was diese oder
wenigstens eine ähnliche Verfassung erreicht hatte, bewiesen
dreieinhalb Jahrhunderte später Leonidas und seine Schaar in dem
Engpass der Thermopylen. Die Idee der Rasse-Veredelung lag wenigstens
zum Theil auch der Sitte der alten Germanen zu Grunde, dem Vater zu
gestatten, schwächliche, hässliche oder sonst nicht passende Neugeborne
zu tödten.Vgl. auch Uffelmann, Handbuch der privaten und öffentlichen
Hygiene des Kindes. Leipzig 1881. S. 4, 5 u. 12. Auch die ger-
manischen Freien und Edelfreien, sowie die Kasten vieler andrer Völker
und Zeiten verstanden oft vortrefflich oder versuchten es wenigstens,
die Rasseinteressen ihrer Körper- schaft wahrzunehmen. Heutzutage ist
bei den Culturnationen das Verständ- niss und die Pflege von
Rasseinteressen beschränkt einer- seits auf die regierenden
Fürstengeschlechter und den Adel, andrerseits auf Rennpferde,
Jagdhunde, Rindvieh und sonstige Hausthiere. Das Christenthum und die
moderne Demokratie mit ihren Gleichheitslehren und -Forderungen haben
in den Massen den Sinn für Rasse so abgeschwächt, dass der Conflict
zwischen den humanitär-socialistischen Forderun- gen und dem Rassenwohl
gar nicht mehr in ihr Bewusst- sein dringt. In den Massen, sage ich. In
dem kleinen Kreise der Führer und Forscher ist durch Darwin’s Auftreten
und das politische Vordringen der Social- demokratie das
Rasseninteresse wieder sehr lebendig geworden, und die Schwerthiebe
grosser und kleiner Ritter vom Geist rasseln fröhlich durch die
Frühlings- lüfte der modernen Wissenschaft. Hie Sozialismus — hie
Darwinismus, hinter diesem Feldgeschrei bergen sich nichts weiter als
die auf die Politik angewandte Individual- hygiene, die für jeden
Einzelnen die möglichst günstigen Entfaltungsbedingungen schaffen
möchte, und die Rassen- hygiene, die das Ausmerzen der schwachen und
schlechten Individuen für das Wohl der Rasse nicht glaubt entbehren zu
können. Manche Forscher zwar haben bei der Definition von Hygiene das
Hauptgewicht auf das Wohl der Gesammt- heit gelegt, wie z. B. Prof.
Demme, der Berner Kinder- Kliniker, in folgenden Worten: „Hygiene
sammelt wie in einem Brennpunkt die gesammten Resultate wissenschaft-
licher medizinischer Forschung, soweit sie zum Wohl des Staates und
Volkes Verwendung finden können.“Demme, R. Ueber den Einfluss des
Alkohols auf den Organis- mus des Kindes. Rede. Stuttgart 1891 S. 4.
Allein er ist sich des Zwiespalts nicht weiter bewusst geworden. Andere
wieder haben den Zwiespalt abgeläugnet. So sagt Georg in seiner
socialen Hygiene: „Indessen hat es der frisch aufstrebenden
Wissenschaft auch an ernsten Gegnern nicht gefehlt. Da sind zunächst
die consequen- ten Darwinianer, die der socialen Hygiene nicht gewogen
sind. Sie werfen ihr vor, die natürliche Auslese zu ver- fälschen,
welche die lebensschwachen Elemente sonst im Kampf um’s Dasein zu
Grunde gehen lässt und ein kräf- tiges Geschlecht verbürgen würde. …
Hierauf ist, ganz abgesehen von der humanitären Seite der Sache, zu er-
wiedern, dass die soziale Hygiene den Kräftigen und Ge- sunden nicht
minder Schutz gewährt als den Schwachen und Kranken.“K. Georg. Soziale
Hygiene. Berlin und Leipzig 1890 S. 8. Auch Rosenthal und Rubner
äussern sich in ähn- licher Weise.J. Rosenthal. Vorlesungen über die
öffentliche und private Gesundheitspflege. Erlangen 1887 S. 5. Max
Rubner. Lehrbuch der Hygiene. Leipzig und Wien 1890 S. 3. Es ist
offenbar, dass mit dieser Abläugnung des Wider- streits nichts gewonnen
wird. Die Kräftigen und Gesunden brauchen eben den Schutz der Hygiene
nicht, wenigstens nicht in dem Maasse als die Schwachen, und sind nur
häufiger der Vermischung mit den Schwachen ausgesetzt. Auch das
Argument, seit grösserer Ausbreitung hygieni- scher Maassregeln habe
die durchschnittliche Lebensdauer bedeutend zugenommen, also die
gesammte Rasse davon nicht nur keinen Schaden, sondern Vortheil gehabt,
darf nicht ohne Weiteres zugelassen werden. Denn die Lebens- dauer ist
die Resultante zweier entgegengesetzter Compo- nenten, der
Constitutionskraft der Individuen und der Summe der schädlichen
Einwirkungen darauf. Die Resul- tante, die Lebensdauer, kann bei
Verminderung der schäd- lichen Einwirkungen in zweierlei Art steigen,
erstens wenn die Constitutionskraft zunimmt oder wenigstens gleich
bleibt, zweitens aber auch, wenn letztere abnimmt, nur muss diese
Abnahme dann im Verhältniss geringer sein als die der Schädlichkeiten.
Mit anderen Worten: ein irdener Topf kann länger aushalten als ein
eiserner, wenn er nicht so häufigen und starken Stössen wie dieser
ausgesetzt wird. Dass wir von dem Eisen in unserer Constitutionskraft
wirklich verloren haben, geben sogar Rosenthal und Georg, sonst aber
auch eine Menge der hervorragendsten Forscher zu, aller- dings im
Widerspruch mit anderen. Die Berechtigung zur Gegenüberstellung von
Indivi- dual- und Rassen-Hygiene bleibt also bestehen, und es er- hebt
sich nun die Frage, welche von den beiden wir prinzipiell als die
dominirende anzusehen haben. Der erste Maassstab aller menschlichen
Thätigkeit ist die Erhaltung des gesunden, kräftigen, blühenden Lebens.
Dieser Maassstab ergiebt sich ebenso aus der objectiven Betrachtung des
Menschen als eines sich selbst erhalten- den anziehenden und
abstossenden Mechanismus, als aus den Urmotiven der Triebwelt, den
Erhaltungstrieben, deren Nicht- befriedigung als Unlust, deren
Befriedigung als Lust unserer Psyche direct offenbar wird. Man lese
hierüber nach in der „Metaphysik in der modernen Physiologie“ von
Haupt- mann, einem der geistvollsten und bedeutendsten Werke, das auf
dem Grenzgebiete der Physiologie und Philosophie in letzter Zeit
erschienen ist. Karl Hauptmann. Die Metaphysik in der modernen
Physiologie. Eine kritische Untersuchung. Jena. G. Fischer. 1894. Aus
den Erhaltungsbestrebungen des Individuums ist auch die
Individualhygiene hervorgegangen und bildet ihre am meisten
verfeinerten und vertieften Ausläufer. Als hauptsächlich in den letzten
Jahrzehnten entwickeltes Kind des Jahrhunderts ist sie ein wenig von
der fin de siècle-Gesinnung angesteckt worden: Nach uns die Sint-
fluth. Was bei ihrem flotten Wirthschaften aus dem Wohl der spätern
Geschlechter wird, hat sie nicht viel gekümmert. Grade an die späteren
Geschlechter nun knüpft die Rassenhygiene an, die hier in Bezug auf die
Nach- kommenden mit dem Prinzip der individuellen Hygiene
übereinstimmt, das höchste Wohl möglichst Vieler zu wollen. Der Begriff
Rasse knüpft sich nicht an eine Generation, sondern an viele auf
einander folgende, deren Werden und Vergehen das Leben der Rasse erst
bilden. Für ein Geschlecht ist daher das unmittelbare Ziel der
Rassenhygiene immer das Wohl des nächsten. Daraus ergeben sich ihre
Wurzeln in der Triebwelt der Individuen. Das sind die Elternliebe und
das Interesse für die grosse Gemeinschaft, der man angehört, sei es
Familie, Stamm, Volk oder die ganze Gattung, also auch der Patriotismus
und die Liebe zur Menschheit, die meist nichts weiter ist als die Liebe
zu ihrem arischen Theil. Die Eltern, die versuchen, ihre Kinder unter
den möglichst günstigen Umständen zu zeugen und heran- zuziehen, der
Adlige, der die Wahl seiner Frau nach den Erhaltungsinteressen seines
Stammes trifft, der Patriot, der mit Selbstverläugnung die Opfer auf
sich nimmt, die für das Gedeihen seines Volks auch in fernerer Zeit
nöthig sind, der Menschenfreund, der von einem goldenen Zeit- alter
träumt, wo ein besseres, glücklicheres Geschlecht blüht, und der
Künstler, der menschliche Schönheit nicht nur in Marmor und auf
Leinwand, sondern noch viel herrlicher in Fleisch und Blut sehen
möchte, sie alle haben Sinn für die Zukunft der Rasse und sind bereit,
dafür in der Gegen- wart Opfer zu bringen. Sie leben, wie Nietzsche
sagt, mehr für’s Kinderland, als für’s Vaterland. Alle diese Motive
bilden psychische Erhaltungsvor- richtungen für die Art, knüpfen aber
auch schliesslich alle an individuelle Lust- und Unlust-Empfindungen
an; die Glücksfähigkeit der Nachkommen ist das Ziel. Ueber den Inhalt
des menschlichen Glücks sind die Meinungen sehr verschieden. Es wäre
trivial, dies weiter auszuführen. Aber in dem Punkt dürfte doch
Ueberein- stimmung herrschen, dass es für das Lebensglück Aller eine
Grundlage gemeinsamer notwendiger Bedingungen giebt, wie Gesundheit,
körperliche und geistige Kraft, Ver- fügungsrecht über ein gewisses
Minimum wirthschaftlicher Güter etc., und dass es ausserdem eine Reihe
von wünschens- werthen Bedingungen giebt, deren Erfüllung nicht grade
für Jeden zu seinem dauernden Wohlsein unumgänglich nöthig ist, aber
doch von Allen als sehr begehrenswerther Zuwachs empfunden wird, wie z.
B. schöne Körperformen, eine hübsche Wohnung, ein hübscher Garten,
Kunstwerke etc. Und hier setzt ein ausschlaggebendes Moment ein. Die
Erhöhung der innern, in unsern Eigenschaften liegenden
Glücksbedingungen, also die Vervollkommnung der Menschheit, ist nur in
sehr beschränkter Weise ein Problem in Bezug auf das Leben des
Individuums. Aeussere Eindrücke, Erziehung, Uebung von Functionen
können nur gegebene Anlagen bis zu einem bestimmten Punkte ent- falten,
so dass sie für das betreffende Individuum besser functioniren, aber
die Steigerung der guten Anlagen bei der Vererbung auf die nächste
Generation, also die wirk- liche Vermehrung des Kapitals menschlicher
Glücksfähigkeit, ist ein Problem des Gattungslebens und fällt daher
voll- kommen in die Sphäre der Rassenhygiene. Die Vervollkommnung muss
noch aus den Gründen neben der blossen Erhaltung der Gattung Object der
Rassenhygiene bleiben, weil nicht nur die Wege zur blossen Erhaltung
unmerklich in die der Vervollkommnung übergehen, sondern auch, weil bei
allen rassenhygienischen Maass- nahmen das Resultat der blossen
Erhaltung bei der Un- sicherheit unserer Methoden nur dann mit
Sicherheit erreicht werden würde, wenn wir die Vervollkommnung
erstreben. Die Steigerung unsrer Gehirnanlagen ist die nothwen- digste
Bedingung einer Verbesserung unserer Glücksbedin- gungen, die wir
kennen. Aller Fortschritt hierin heisst besseres Erkennen und dadurch
leichteres Beherrschen unserer eigenen und der äusseren Natur. Werkzeug
und Waffe dafür ist unser Gehirn. Nur eine Steigerung seiner Anlagen
von Geschlecht zu Geschlecht kann der Mensch- heit die nöthige Kraft
geben, sich den umklammernden Armen des Elends zu entringen. Die
Rassenhygiene, das Bestreben, die Gattung gesund zu erhalten und ihre
Anlagen zu vervollkommnen, muss also das herrschende Princip bleiben,
und die Individual-Hygiene sammt ihren socialen und politischen
Ausläufern muss sich unterordnen, sobald sie dies Princip ernstlich
gefährdet. In den folgenden Blättern soll zuerst der allgemeine Theil
der Rassenhygiene abgehandelt werden, nämlich die Praecisirung der
genaueren Ziele sowohl für die Erhaltung, als die Vervollkommnung der
Rasse; die bisher in dieser Richtung wirkenden Factoren; die Diskussion
der Frage, ob wir heute degeneriren oder nicht; schliesslich die For-
mulirung der allgemeinen rassenhygienischen Anforderungen an Staat,
Familie, und Individuum und ihre Zusammenhänge mit den
social-oekonomischen Systemen, die zu einem Schutz der Schwachen
tendiren. In einem zweiten Theil, der speciellen Rassenhygiene, sollen
die Mittel besprochen werden, diesen Anforderungen gerecht zu werden;
er wird nach einer Besprechung des Schutzes der guten Variationen im
Wesen eine Unter- suchung über die Mittel zur Erzeugung tüchtiger Nach-
kommen enthalten. 1. Capitel. Allgemeine Factoren der Erhaltung und
Entwickelung. Der Gesammtprocess. Darwin — Wallace. — Vererbung.
Keimplasma. Vererbung erworbener Eigenschaften. Praeformation und
Epigenese. — Variation. Ursachen. Keimauslese. Befruchtung. Spätere
Wirkungen. Grenzen und Häufigkeit der Variirens. Vererbung von
Variationen. — Kampf um’s Dasein und natürliche Auslese.
Vermehrungstendenz der Wesen. Regulationen im Organismus.
Constitutionskraft. Extral- und Socialwirkungen. Nonselectorische und
selectorische Factoren. Starke u. schwache Varianten. Kampf der
Societäten. — Bedeutung der drei Entwickelungsfactoren. Der
Gesammt-Process. Die menschliche, überhaupt die gesammte organische
Entwickelung wurde unserem Verständniss bisher am näch- sten gebracht
durch die Untersuchungen von Darwin, Wallace und ihren Nachfolgern,
wenn auch für die Auf- deckung der eigentlichen mechanischen Vorgänge
dabei wenig geleistet wurde. Wen es interessirt, wie weit es nach dem
heutigen Stande unseres Wissens überhaupt nur gelingen kann,
Lebenserscheinungen auf rein mechanischem Wege zu erklären, sei auf
Karl Hauptmann’s Darstellung in seiner „Metaphysik in der modernen
Physiologie“ hin- gewiesen und zwar hauptsächlich auf den fünften Theil
des Buchs: Leitende Gesichtspunkte für eine dynamische Theorie der
Lebewesen. Karl Hauptmann, a. a. O. pag. 315. Am meisten Licht wurde
noch verbreitet über die Formen des Kampfes um’s Dasein in speciellerem
Sinne. Vererbung und Veränderlichkeit blieben ziemlich im Dun- keln.
Ihrem geheimnissvollen Weben zu lauschen wird immer wieder die Forscher
reizen. Und wenn sie wohl noch auf lange unfähig sein werden, ein
volles mechanisches Verständniss dieser Erscheinungen herzustellen, so
wird doch schon das Auffinden entfernterer Abhängigkeiten fruchtbare
practische Gesichtspunkte ergeben. Das Leben der Menschheit verläuft in
demselben grossen Rahmen wie das der übrigen Thiergattungen. Es werden
zuviel Nachkommen gezeugt, als dass die Ver- mehrung der für sie
erreichbaren Nährstellen damit Schritt halten könnte. Aus dem Nachweis
dieser Thatsache für die Menschen durch Malthus Malthus, Versuch über
das Bevölkerungsgesetz. Berlin 1879. schöpfte Darwin bekannt- lich die
Anregung zu seiner Theorie. Aus dem Missverhältniss ergiebt sich ein
Wettbewerb um Nahrung und indirekt um Fortpflanzung und Kinder- pflege,
der Sieg des stärkern Theils, die mehr oder minder vollständige
Unterdrückung und das Elend des schwächern Theils. Aber dieser
Wettbewerb mit seinen ungeheuren Opfern an menschlicher Glückseligkeit
war, wie Darwin und Wallace dargelegt haben, andrerseits auch eine der
Bedingungen der Erhaltung und Vervollkommnung der Gattung. Es giebt
ausser der Selections-Theorie noch verschiedene
Entwickelungshypothesen, die sich aber nicht entfernt einer solchen
weitverbreiteten Anerkennung unter den Wissen- schaftlern erfreuen, und
die das Stadium nebelhafter Hypo- thesen so wenig überwunden haben,
dass ich mich in diesen Blättern darauf beschränken muss, nur die
Darwin- Wallace’sche Form der Entwickelungslehre in’s Auge zu fassen,
also die Selectionstheorie mit ihren drei Factoren: Variation, Auslese
und Vererbung. Höchstens können wir über die relative Bedeutung der
einzelnen Factoren streiten. Besonders kommt dies für die Auslese in
Betracht, die der einzige der drei Factoren ist, der auch nach Darwin’s
Zugeständniss in manchen Fällen eine nur facultative Be- deutung haben
kann. Die Kinder haben etwas andere Eigenschaften als ihre Eltern, sie
variiren. Von diesen neuen, oder anders gra- duirten Eigenschaften sind
einige im — bewussten und unbewussten — Kampf um’s Dasein, d. h. um die
Existenz und den Nachwuchs den Trägern vortheilhaft und helfen mit
dazu, dass sie erfolgreicher darin sind, mehr und kräftigere Kinder
aufzubringen als diejenigen, die diese Eigenschaften nicht oder in
nicht so hohem Grade haben. Auf einen Theil der Kinder werden diese
Eigenschaften wieder vererbt, einige Male sogar in erhöhtem Grade;
dieser Theil ist dadurch wiederum im Kampf um das Dasein begünstigt und
vererbt seinerseits die Eigenschaften weiter. Wenn nun diese neuen
Eigenschaften, die ja zu- erst nur geringe Unterschiede von den Eltern
zu bedeuten brauchen, bei den Nachkommen immer wieder im Sinne ihrer
steigenden Entwickelung variiren und im Kampf um’s Dasein ausgelesen
werden, so werden auf diese Weise die Besitzer der neuen Eigenschaften
im Lauf der Genera- tionen einen immer grösseren Procentsatz der Art
aus- machen, bis sie schliesslich alle übrigen Individuen ver- drängt
haben, und die Art nunmehr bloss aus den Indivi- duen mit diesen neuen
Eigenschaften besteht. Es muss ausdrücklich bemerkt werden, dass das
Wort „Kampf um’s Dasein“ im Sinne Darwin’s die Concurrenz in Bezug auf
das Hinterlassen von Nachkommenschaft ein- schliesst. Darwin selbst
sagt: „Ich will vorausschicken dass ich diesen Ausdruck, Kampf um’s
Dasein, in einem weiten und metaphorischen Sinn ge- brauche, unter dem
sowohl die Abhängigkeit 2 der Wesen von einander, als auch, was
wichtiger ist, nicht allein das Leben des Individuums, sondern auch
Erfolg in Bezug auf das Hinter- lassen von Nachkommenschaft
einbegriffen wird. Darwin. Entstehung der Arten. Uebersetzt von Carus.
Stutt- gart 1876 S. 84. Sehr häufig, besonders von Sozialisten, ist
dieser Be- griff nicht auf die Fortpflanzung erstreckt und also falsch
aufgefasst worden; es ist desshalb auch oft genug von
Naturwissenschaftlern bemerkt worden, dass er unglücklich gewählt ist.
Aber er hat sich einmal eingebürgert und desshalb müssen wir ihn
beibehalten. Wir müssen uns eben denken, dass die Kinder gewissermassen
zum Sein der Eltern hinzugehören. Um es bei der grossen Wichtig- keit
des Gegenstandes noch einmal zu wiederholen: der Kampf um’s Dasein
begreift in sich sowohl den Kampf des Individuums um seine eigene
Erhaltung, als den um einen geeigneten Gatten und schliesslich den um
das Auf- bringen der erzeugten Kinder, die ja in der nächsten
Generation den gegen die vorige vermehrten oder ver- minderten Antheil
des elterlichen Blutes ausmachen. Ein Unterliegen im Kampf ums Dasein
tritt also ein, wenn das Individuum vorher stirbt, ehe es zur
Fortpflanzung kommt, oder wenn es aus irgend einem Grunde keinen Gatten
findet, oder wenn die Verbindung mit dem Gatten unfruchtbar bleibt,
oder wenn von den erzeugten Kindern bis zur vollendeten Brutpflege
weniger erhalten bleiben, als zum prozentualen Ersatz der Eltern nöthig
sind. In diesem Falle wäre natürlich auch der andere Gatte durch die
Schädi- gung seiner Fortpflanzung in gleichem Maasse unterlegen. Eine
Behauptung im Kampf um’s Dasein findet statt, wenn die Zahl der
erhaltenen Kinder dem Antheil der Eltern an der Art entspricht, ein
Siegen über andere Theilnehmer, wenn eine grössere Zahl Kinder erhalten
bleiben. Zur Illustration ein thatsächliches Beispiel aus dem
Thierreich. Bei den russischen Wölfen zeigt sich in immer wachsender
Zahl eine langbeinige Spielart. Darwin würde diese etwa so erklären:
Unter den Jungen werden ab und zu einige geboren, die etwas längere
Beine mit auf die Welt brachten als ihre Mitwölfe. Zur Zeit des
Nahrungsmangels, im Winter, wo viele Wölfe zu Grunde gehen, ist diese
neue Eigenschaft ein grosser Vortheil. Ein weiteres Areal kann nach
Nahrung durchstreift und die Beute besser verfolgt werden. Dadurch
überwintern die Langbeine in verhältnissmässig grösserer Zahl als die
Kurz- beine und machen, da sie durch Vererbung zum grossen Theil die
neue Eigenschaft übertragen, in der nächsten Generation einen etwas
grösseren Procentsatz der Art aus als früher. Wenn dieser Process des
öfteren Erzeugens der langbeinigen Spielart und ihrer Auslese im Kampf
um’s Dasein sich durch sehr viele Generationen wiederholt, so muss
allmählich die russische Wolfsart fast nur noch lang- beinige Exemplare
aufweisen. Bei den Menschen findet mutatis mutandis derselbe Vorgang
statt. Vergleichen wir den heutigen Cultur- menschen mit dem noch heute
lebenden Wilden, also mit Menschen, die unsern Vorfahren ähnlich sind,
so fällt am meisten unsere stärkere Gehirnentwickelung auf und damit
verbunden unsere höhere Intelligenz, die uns über die niedriger
entwickelten Stämme hat siegen lassen. Auch die socialen Instincte (im
Sinne Darwin’s) haben sich vervoll- kommnet. Der Fortschritt in diesen
beiden Punkten ist jedenfalls der wichtigste, und sein Andauern zur
weiteren Entfaltung des Menschengeschlechts unumgänglich nöthig.
Selbstverständlich ist neben der Entwicklung der Intelligenz und der
socialen Instincte die Erhaltung der Consti- tutions- und
Fortpflanzungskraft gegangen. Alle Individuen, die in diesen beiden
Punkten schwach beanlagt waren, wurden durch die äusseren
Schädlichkeiten beeinträchtigt, 2* oder hatten bei Vermischung mit
Kräftigeren die Tendenz, die Nachkommen leichter unterliegen zu lassen.
Wir müssen diesen Erhaltungs- und Umänderungsprocess mit seinen drei
Grundphaenomenen, der Variation oder Abänderung der Nachkommen, der
Auslese (Zuchtwahl, Selection) der guten Variationen durch den Kampf
um’s Dasein und drittens der Vererbung der elterlichen Eigenschaften
auf die nächste Generation, für unsere Zwecke noch etwas näher
betrachten. Vererbung. Unter Vererbung Zum Studium der Vererbung
empfehlen sich: Darwin, Ch. Das Variiren der Pflanzen und Thiere im
Zustand der Domestication. Cap. 27. — Galton Fr., Natural Inheritance,
London 1889. — Haeckel, E. Perigenesis der Plastidule 1876. — Hertwig,
O. Die Zelle und die Gewebe. Jena 1892. und Zeit- und Streitfragen der
Bio- logie, Heft I. Praeformation oder Epigenese? Jena 1894. — Hertwig,
O. und R. Problem der Befruchtung und Isotropie des Eies, eine Theorie
der Vererbung. Jena 1884 — Ribot, Th. Die Erblichkeit. Deutsch von
Hotzen. Leipzig 1876. — Roth. E. Die Thatsachen der Vererbung. II.
Aufl. Berlin 1885. — Spencer: H. Die Principien der Biologie. Deutsch
von Vetter. Stuttgart 1876. — Vries, H. In- tracellulare Pangenesis.
Jena 1889. — Weismann, Aug. Das Keim- plasma, eine Theorie der
Vererbung. Jena 1893. versteht man jedes Wiederauftreten von
Eigenschaften der Eltern bei den Nachkommen durch den Akt der
Fortpflanzung hindurch. Oft werden die elterlichen Anlagen beim Kinde
bis auf feinste Einzelheiten wiederholt. Die Erblichkeit ist die
Tendenz, die Kinder den Eltern gleich zu machen, sie ist also der
grosse conservative Factor in der Natur, der viele von den neu
aufgetretenen wie auch die alten Eigenschaften zu erhalten strebt. In
so fern be- steht zwischen der Vererbung und der Veränderlichkeit oder
Variabilität der Organismen ein gewisser Gegensatz. Die Variabilität
vereinigt das fortschrittliche und reaktionäre Princip, sie ändert eben
nur um, fügt entweder den ver- erbten Charakteren hinzu, modificirt sie
oder nimmt etwas von ihnen fort. Einige specielle Bezeichnungen der
Vererbung sind für unsere Zwecke nöthig. Von „Vererbung im
entsprechenden Lebensalter“ (homochrone Vererbung Haeckel’s) spricht
man, wenn Eigenschaften, die bei einem Elter in einem bestimmten
Lebensalter auftraten, auch bei dem Kinde in demselben Lebensalter
auftreten. Hierher gehört das Eintreten der Pubertät, das Erscheinen
der secundären Geschlechts- charaktere, aber auch sehr individueller
Eigenheiten. Streng genommen gehört es zum Begriff der Vererbung, dass
sie homochron ist; denn wenn z. B. eine Tochter mit 10 Jahren in die
Pubertät eintritt, während die Mutter, die unter denselben Bedingungen
aufwuchs, erst mit 14 Jahren mannbar wurde, so hatte sie eben einen
anderen Organismus und gleicht in dem herangezogenen Punkte nicht der
Mutter, sondern stellt eine Variation dar. Auch die „gleichörtliche“
Vererbung ist selbstverständlich und ein Pleonasmus. Unter „gekreuzter
Vererbung“ versteht man die Ver- erbung einer Eigenschaft von dem einen
Geschlecht der Eltern auf ein anderes Geschlecht bei den Kindern, also
z. B. vom Vater auf die Tochter. Dies wird nicht nur unmittelbar
beobachtet, sondern auch in mehr latenter Weise, wenn z. B. Jemand
schon in jungen Jahren eine graue Locke an einer bestimmten Stelle des
Bartes be- sitzt, die in ähnlicher Weise bei dem Sohn seiner Tochter
wieder auftritt. Von „gemischter Vererbung“ spricht man im Hin- blick
auf die Thatsache, dass ein Kind Eigenthümlichkeiten von beiden Eltern
in sich wiederholt. Verschiedene andere Bezeichnungen, die man aufge-
stellt hat, wie atavistische, pot- und praeponirende, un- gleichartige
und noch manche andere gehören streng ge- nommen nicht unter den
Begriff Vererbung, sondern unter den der Variabilität, und werden dort
ihre Erwähnung finden. Dies gilt auch, wenigstens zum Theil, von der
„latenten Vererbung“, wo bei einer oder mehreren Zwischen- generationen
die betreffende Eigenschaft nicht zur Ent- wickelung kommt. Das nähere
Geschehen bei der Vererbung ist noch nicht sehr aufgeklärt. Zwar
darüber ist man ziemlich im Einverständniss, dass der Process
hauptsächlich an die Kernsubstanz der Ei- und Samenzelle gebunden ist,
die, von beiden Eltern herrührend, durch die Begattung einander nahe
gebracht werden und bei der Befruchtung zu einem neuen Kern in der
Eizelle verschmelzen, aus der dann durch Theilung alle späteren Zellen
des neuen Körpers hervorgehen. Allein es bestehen doch noch so wichtige
Meinungs- verschiedenheiten, dass sehr bedeutende Fragen, wie die der
Herkunft der Keimstoffe in Bezug auf den elterlichen Organismus noch
ungelöst sind. Ob direkte Abstammung der Keimsubstanz eines Individuums
von der Keimsubstanz seiner Eltern besteht, oder ob die Keimstoffe
eines Indivi- duums neu von den Körperzellen desselben Individuums
wiedergebildet werden, das ist eine wichtige und dement- sprechend
stark ventilirte Frage. Francis Galton und Weis- mann, sowie die
zahlreichen Anhänger ihrer absoluten Weigerung, irgend eine Art der
Abstammung von Keim- plasma aus Körperplasma anzunehmen, stehen in
diesem Streit gegen Darwin, Haeckel, Hertwig, Romanes, Spencer, Vries
und andere. Für uns hat dieser Streit insofern Bedeutung, als die Frage
der sog. „Vererbung erworbener Eigenschaften“ eng damit verbunden wird
Vergl. auch Ernst Ziegler. Können erworbene pathologische. Unter
erworbenen Eigenschaften werden in dieser Discussion Eigenschaften
verstanden, die von einem Individuum zu irgend einer Zeit im Lauf
seines gesammten Lebens erworben wurden, also von der Zeit an, wo es
noch eine ungetheilte, aber schon befruchtete Eizelle war, bis zu
seinem Tode. Hierhin gehören haupt- sächlich die Resultate der Uebung
und Nichtübung. Alle vor oder durch das Zusammentreffen der elterlichen
Keimstoffe von diesen letzteren erfahrene Aenderungen werden nicht
erworbene, sondern anerzeugte Eigenschaften genannt. Weismann hielt die
Entscheidung dieser Frage natürlich für seine Theorie der Continuität
der Keimplas- mata von grosser Bedeutung, da der Nachweis der Ver-
erbung erworbener Eigenschaften, also der Wieder- holung von
Eigenschaften, die von der Körpersub- stanz erworben waren, durch den
Keimstoff, sehr gegen seine Annahme in’s Gewicht fiel. Desshalb haben
er und seine Anhänger, begünstigt durch die weit verbreitete
Schwierigkeit, bei den Charakteren eines Individuums den Antheil der
Anlagen und der äusseren Einwirkungen fest- zustellen, bisher jede
thatsächliche Berechtigung der An- nahme des Vererbens erworbener
Eigenschaften abge- stritten, in einer Weise, die uns nicht gestattet,
diese Form der Vererbung als unzweifelhaft vorkommend und dess- halb
als wirksamen Entwickelungsfactor anzunehmen. Auch die angestellten
Experimente, die ausnahmslos die Vererbung nur von Verletzungen
betrafen, sind nicht zwingend, am ehesten noch die Brown-Sequard’schen
über die Vererbung der künstlichen Epilepsie der Meer- schweinchen. Mit
Sicherheit geht jedenfalls aus der ganzen Discussion hervor, dass eine
Vererbung erworbener Eigen- schaften, also auch von Uebungsresultaten,
bis jetzt nicht als verlässlicher Entwickelungsfactor von uns in
Rechnung gestellt werden kann. Eigenschaften vererbt werden und wie
entstehen erbliche Krankheiten und Missbildungen? Jena 1886. Es wäre
sehr zu wünschen, dass Experimente in dieser Richtung angestellt
würden, die positive Uebungsresultate, nicht Defecte, zur Basis nähmen.
Bei der einen Hälfte einer grossen Anzahl von unter gleichen
Bedingungen aufgewachsenen Thieren müssten die Resultate der maxi-
malen Uebung eines Organs notirt werden. Die andere Hälfte müsste in
der Nichtübung verharren. Bei allen Nachkommen beider Gruppen, die sich
untereinander nicht mischen dürften, werden nun die Resultate der
maximalen Uebung des verglichenen Organs festgestellt. Stellt sich eine
grössere Leistung bei der Gruppe heraus, die von den geübten Thieren
abstammt, so könnte man, falls eine genügend grosse Anzahl von
Versuchsthieren verwendet wäre, und Nachprüfungen dasselbe Resultat
liefern würden, die Vererbung von Uebungsresultaten in Form einer ge-
steigerten Anlage nicht leugnen. Die ursprüngliche An- zahl der
Versuchsthiere muss gross genug sein, um bei Theilung in zwei
willkürliche Hälften die Anlagen des zu prüfenden Organs als
durchschnittlich gleich bei beiden Hälften annehmen zu können. Hier
giebt’s Aufgaben für reiche, oder sagen wir lieber sehr reiche Freunde
der Wissenschaft. Im Anschluss noch ein paar Worte über die Weis-
mann’sche Theorie, insofern sie Bedeutung für die Ent-
wickelungsfactoren hat. Bei Annahme der Weismann’schen Lehre der
Continuität der Keimstoffe ist man natürlich keineswegs gezwungen,
irgend eine Einwirkung der Körper- zellen und der Aussenwelt durch die
Körperzellen auf den Keimstoff zu leugnen. Das thut auch Weismann nicht
mehr. Die Beeinflussbarkeit giebt eben Anlass zum Ent- stehen von
Variationen. Von einer Vererbung könnte man aber erst dann sprechen,
wenn die durch die Aussenwelt an den Körperzellen hervorgerufene
Veränderung solche Folgen für das Keimplasma hätte, dass die gleiche
Ver- änderung im Kinde aufträte. Diese Möglichkeit ist jedoch auch bei
Annahme der Weismann’schen Lehre offen. Man könnte sich denken, dass
die Organe in chemischer Be- ziehung den Theilen der Keimstoffe sehr
ähnlich sind, aus denen Weismann sie entstehen lässt, den
Determinanten. Wenn nun irgend welche klimatische, toxische oder
Uebungs- einflüsse, die ja schliesslich alle den Körper chemisch
verändern, auf denselben einwirken, so ist es möglich, dass ausser
einem gewissen Organ oder Organsystem der chemischen Aehnlichkeit
halber auch der entsprechende Theil des Keimstoffes in
correspondirender Art getroffen wird, so dass bei ihm entsprechende
Veränderungen hervorgerufen werden, die die Tendenz haben, bei der
Befruchtung das neue Wesen in derselben Weise geändert entstehen zu
lassen, wie das Elterwesen primär geändert wurde. Noch einen anderen
Theil der Weismann’schen Ver- erbungstheorie wollen wir betrachten, die
Determinanten- lehre, da es von ihrer Annahme abhängt, ob wir uns die
Beeinflussung eines Individuums während seiner Entwicke- lung vom
befruchteten Ei ab leicht oder schwer vorstellen, Dinge, die, im Fall
sich die Vererbung erworbener Eigen- schaften als Thatsache
herausstellen sollte, grosse Bedeu- tung für den Entwickelungsprocess
einer Rasse haben könnten. Weismann betrachtet, wie fast sämmtliche
Autoren, die Kernsubstanz der Keimzellen als den Träger der Ver-
erbungsanlagen. Er nennt die Kernstäbchen „Idanten“ und lässt jeden
Idanten aus einer Anzahl von „Iden“ oder Ahnenplasmen zusammengesetzt
sein. Ein Id entspricht der Entwickelungsmöglichkeit eines Individuums
der früheren Generationen, auch der Eltern. Jedes Id besteht wieder aus
„Determinanten“, eine solche für jede einer selbstän- digen Abänderung
fähige Zelle oder Zellgruppe des spä- teren Lebewesens. Die
Determinanten bauen sich aus ein- zelnen „Biophoren“ auf, welche
einzelne Charaktere der künftigen Zellen bestimmen, und die Biophoren
bestehen aus Molekülen und Atomen. Bei den Zelltheilungen während der
individuellen Ent- wickelung finden ungleiche Kerntheilungen statt,
wodurch die Differenzirung in die verschiedenen Zellarten und Ge- webe
des Körpers ermöglicht wird. Die Art der Zu- sammensetzung des
Keimplasmas (Keimstoffs) bedingt die körperliche und geistige
Organisation des entstehenden Individuums. Im Keimplasma ist ein
bestimmter Aufbau der Bestandtheile, eine Architektur, anzunehmen,
wodurch zu Stande kommt, dass bei der Entwickelung des Indivi- duums
jede Zelle oder Zellgruppe an den richtigen Platz im Organismus zu
liegen kommt. Mit der Befruchtung des Eies ist somit die ganze
Individualität des Kindes be- stimmt. Gegen diese Determinantenlehre
und die ähnliche Mo- saiktheorie von Roux hat sich in jüngster Zeit
Oscar Hertwig Hertwig, O. Zeit- und Streitfragen der Biologie. Heft 1.
Prae- formation oder Epigenese? Jena 1894. gewandt, um einen mehr
epigenetischen Stand- punkt zu betonen. Seine Geltendmachung einer
stets erb- gleichen Theilung der Zellkerne als Thatsache scheint mir
noch nicht berechtigt in Anbetracht unserer für so enorm delikate
Untersuchungs-Objecte wie Kernstäbchen noch sehr rohen Methoden. Seine
andere, speciell epigenetische Argumentation, die den äusseren
Ursachen, die er fort- während von Etappe zu Etappe innere werden
lässt, einen viel grösseren Einfluss zuschreibt wie Weismann und Roux,
hat nur dann Sinn, wenn er die Complication der befruch- teten Eizelle
als geringer ansetzt als die des fertigen Orga- nismus. Das nimmt nun
zwar Hertwig auch ganz aus- drücklich zur Basis seiner Herleitung,
allein durch die Acceptirung von Naegeli’s Satz, (S. 131) dass das Ei
des Huhns vom Ei des Frosches ebenso weit verschieden sei als das Huhn
vom Frosch, möchte es für Einige scheinen, als wenn er wieder
Concessionen machte. Denn, wenn man die Eier irgend einer Art als
einfacher annimmt als die fertigen Individuen derselben Art, so sollte
doch daraus folgen, dass die Eier verschiedener Arten nicht ebenso weit
von einander verschieden sein können als die fertigen Individuen von
einander. Wir wollen desshalb die in Betracht kommenden principiellen
Verhältnisse noch etwas näher erläutern. Weismann geht davon aus, dass
trotz allerlei verschie- dener äusserer Einflüsse doch ein zäher Gang
zu ziemlich gleicher Organisation während der Entwickelung von Kindern
statthat, und dass ferner oft die minimsten elterlichen
Eigenthümlichkeiten, die nur an wenige Zellen gebunden sind, vererbt
werden. Daraus schliesst er, sie müssten bereits im Ei stofflich
vorgebildet sein, und nimmt desshalb im Ei eine dem Elter entsprechend
grosse Compli- cation an. Diese Annahme ist aber rein theoretisch nicht
not- wendig. Zwar ist richtig, dass irgend einer entstandenen
Complication eine vorhergehende gleich grosse Compli- cation
entspricht, wenn man das ganze Riesengewebe des Ursachencomplexes in
Betracht zieht.Ganz genau genommen ist bei Vergleichung von zwei
zeitlich getrennten Complicationen jedesmal der Zusammenhang mit dem
ge- sammten Weltprocess nöthig, da ja jede Kraft fortwährend unter dem
Gesammteinfluss der Welt steht. Wir müssen hier jedoch relativ mög-
liche Vergleiche machen. Wir haben zwei zeitlich verschiedene Complexe
von Kräften zu ver- gleichen. Das müssen wir auch auf den Fall: Ei und
daraus entstandenes Individuum anwenden. In Wirklichkeit haben wir also
gegenüberzustellen den zusammengesetzten Functionencomplex des fertigen
Individuums und den ganzen Complex von Kräften, aus dem er
hervorgegangen ist. Dieser letztere besteht aber nur z. Th. aus den
Kräften, die an das befruchtete Ei gebunden sind. Der andere Theil wird
von dem ganzen complicirten Complex der Um- gebungskräfte gebildet. Nun
ist es durchaus nicht noth- wendig, dass bei den beiden Kräftecomplexen
der Antheil der zu einem lebendigen Individuum centrirten Kräfte gleich
ist. Nur die Gesammtsumme muss gleich sein. Das eine Mal, beim Ei, kann
der Kräftecomplex, der zum Lebe- wesen gehört, von dem gesammten
Ausgangscomplex der Entwickelung nur einen kleinen Theil ausmachen,
kann also weniger complicirt sein, als das spätere Mal beim Individuum,
wo ein grösserer Theil äusserer Kräfte in das wachsende Wesen als
innere Anlage eingegangen ist. Man könnte sich also ganz gut bei einer
einfacheren Zusammensetzung des Eies beruhigen und der Epigenese einen
bedeutend weiteren Spielraum einräumen als Weis- mann es thut. An einem
Gleichniss wollen wir uns das Verhältniss noch etwas anschaulicher
machen: Wir haben einen mit Schnee bedeckten Berg, dessen einer Abhang
nur Felsen mit Flechten und Moos, dessen anderer Abhang dagegen weiter
thalwärts mit Moos, Knieholz und Nadelholz bestanden ist. Die Spitze
des Berges ist kegelförmig, etwas weiter unten erhebt sich zwischen den
beiden beschrie- benen Abhängen ein scharfer Grat. Grade da, wo der
Grat aus dem kegelförmigen Theil entspringt, liegt ein Stein so vor dem
bewaldeten Abhang, dass er eine schief nach aussen und abwärts gehende
Fläche dem kahlen Abhang zukehrt. Oben an der Bergspitze löst sich nun
eine kleine Schnee- masse ab und rollt, sich vergrössernd zu einem
kleinen Ball, hinunter bis zu dem Stein. Zu schwach, über den Stein
hinüberzurollen, wird der Schneeball von der schiefen Fläche des Steins
so abgelenkt, dass er nach dem kahlen Abhang zu weiter hinabrollt, um
unten als Lawine aus Schnee, Felsgeröll und niederen Pflanzen
anzukommen. Das befruchtete Ei gleicht der in’s Rollen kommenden
Schneemasse, das entstandene Individuum der zu Thal gegangenen Lawine.
Eine dem Individuum gleiche Com- plication des befruchteten Eies
braucht man ebenso wenig anzunehmen — ehe sie nicht durch zwingende
Schlüsse auf Grund von gesicherten Beobachtungen bewiesen wird — als
eine derjenigen der Lawine gleiche Complication in der sich ablösenden
Schneemasse. In Wirklichkeit hatte es natürlich sehr complicirte
Ursachen, dass sich eine Schnee- masse ablöste, grade in der bestimmten
Grösse, von der bestimmten Dichtigkeit, von der bestimmten Entfernung
unter dem Gipfel, von der bestimmten Richtung etc. Nur die grob
sinnliche Concentrirung einiger dieser ursächlichen Momente in der
Schneemasse bringt uns zur Gegenüber- stellung mit der Lawine. Wir
können dies Bild noch weiter brauchen, um an- schaulich zu machen, wie
die befruchteten Eier sehr ver- schiedener. Arten lange nicht so
verschieden zu sein brauchen, als die ausgewachsenen Individuen es
sind. Nehmen wir an, die ursprüngliche Schneemasse, die in’s Rollen
kam, wäre grösser gewesen, so dass der Ball, der bis zum Stein
entstanden war, auch ein gut Theil grösser geworden wäre und Kraft
genug gehabt hätte, über den Stein hinwegzurollen. Dann wäre die
Schneemasse nach dem bewaldeten Abhang zu gerollt, hätte als wachsende
Lawine nicht nur Schnee und Felsgeröll, sondern auch Moose, Knieholz,
Fichten, allerlei andere Pflanzen und Thiere, vielleicht Häuser und
Menschen mit sich zu Thal geschmettert. Ihre Zusammensetzung wird eine
ganz an- dere, sehr viel complicirtere sein, als die der ersten La-
wine. Die ersten Keime waren anscheinend so ähnlich, nur quantitativ
verschiedene Schneemassen. Wir könnten sogar die beiden ersten
Schneemassen ganz gleich an- nehmen, und uns denken, dass kurz vor dem
Prellstein ein Windstoss den rollenden Ball dem bewaldeten Abhang
zutriebe, so dass er trotz der gleichen Grösse diesmal einen anderen
Weg nähme als der erste. Damit wäre veranschaulicht, dass sehr
verschiedene, grob sinnlich be- grenzte Endmassen sogar aus gleichen
Anfangsmassen ent- stehen können, wenn nur die äusseren Einwirkungen
ver- schieden werden. Dies würde nur noch mehr zeigen, dass wir an und
für sich durch starke Verschiedenheit der Individuen zweier Arten noch
nicht gezwungen sind, den gleichen Grad der Verschiedenheit bei den
befruchteten Eiern anzunehmen, aus denen sie entstehen.
Selbstverständlich will ich damit nicht sagen, dass die Epigenese bei
der Entwickelung des Individuums alles und die Evolution nichts zu thun
hätte. Die Eier haben unzweifelhaft bereits eine ausserordent- lich
complicirte Zusammensetzung, und es handelt sich nur um die Frage,
wieviel beiden Factoren zuzuschreiben ist, und ob durch zwingende
Schlüsse die Epigenese auf einen so völlig unbedeutenden Antheil
beschränkt werden muss, wie Weismann es zu Gunsten seiner Hypothese
thut. Wir wollen durch diese Betrachtung nur verhindern, dass wir ohne
Weiteres, ehe es wirklich durch logische Schlüsse aus einwandsfreien
Thatsachen nöthig ist, den Glauben daran verlieren und dadurch die
Forscher-Arbeit in der Richtung einstellen, dass wir die individuelle
Ent- wickelung besonders in ihren ersten Stadien auch in ihren Anlagen
beeinflussen lernen, was nicht nur für die Entfaltung des einzelnen
Individuums, sondern auch für die Weiterentwickelung der Gattung von
grossem Werth wäre, im Fall sich die Vererbung erworbener Eigenschaf-
ten als möglich erweist. Andrerseits muss auch wieder betont werden,
dass uns die denkbare Möglichkeit sowohl der stärkeren Beein- flussung
der Anlagen des werdenden Organismus in den ersten Stadien der
Entwickelung, als auch der Vererbung er- worbener Eigenschaften noch
nicht dazu veranlassen darf, diese beiden Momente zu Gunsten einer
grösseren Macht- entfaltung der Rassenhygiene in die Reihe der
Entwicke- lungsfactoren aufzunehmen. Ich werde in den späteren
Erörterungen die beiden Momente daher nicht berück- sichtigen.
Variation. Variation Vergleiche über Variation ausser den bereits
früher zum Studium der Vererbung empfohlenen Schriften: Ammon O. Die
natürliche Auslese beim Menschen. Jena 1893. — Brooks, W. K. The Law of
Heredity. Baltimore 1883. — Darwin, Ch. Entstehung der Arten VI.
Stuttgart 1876, besond. Cap. I, II, V. — Eimer, G. H. Die Entstehung
der Arten. I. Theil. Jena 1888. — Häckel, E. Natür- liche
Schöpfungsgeschichte. VII. Aufl. Berlin 1879. IX und X. Vor- trag. —
Hauptmann, K. a. a. O. Fünfter Theil. — Lucas, Prosper. Traité
philosophique et physiologique de l’hérédité naturelle. Paris 1850. —
Wallace, A. R. Der Darwinismus. Braunschweig 1891. bes. Cap. III. u.
IV. — Wiedersheim, R. Der Bau des Menschen als Zeugniss für seine
Vergangenheit. Freiburg 1887. — Ziegler, Ernst a. a. O. S. 34 bis
Schluss. bedeutet im Allgemeinen nichts weiter als das Abändern eines
Organismus von anderen Organis- men. Die Fähigkeit dazu nennt man
Variabilität oder Veränderlichkeit. Dieses Abändern kann sowohl auf die
Eltern eines Individuums bezogen werden, als auf die gleichzeitig
vorhandenen gleichaltrigen Individuen der Art, der es angehört, als auf
den sich aus längeren Zeiträumen ergebenden Durchschnitts-Typus der
Art. Man versteht unter dem Wort Variation nicht nur den Vorgang des
Abänderns, sondern auch sein Resultat, die hervorge- brachten
Unterschiede selbst, ja schliesslich auch die ganzen Organismen, die
die Träger dieser Unterschiede sind. Für unsere Betrachtungen ist es
zweckmässig, wenigstens eine kleine Spezialisirung vorzunehmen. Wir
wollen das Wort Variation beschränken auf den Vorgang des Abänderns und
auf den hervorgebrachten Unterschied. Die Träger der Variationen wollen
wir mit zwei Namen belegen, nämlich Convarianten, sobald das Abändern
auf die gleichzeitig lebenden Altersgenossen der betreffenden Art
bezogen wird, und Devarianten, sobald es auf die Eltern des variirenden
Individuums oder Mit- glieder vergangener Generationen sonst bezogen
wird. Diese beiden Worte scheinen etwas willkürlich gewählt, aber man
kann dem Gedächtniss dadurch zu Hilfe kommen dass man sich denkt, dass
beim Vergleich mit den Eltern und älteren Generationen das eine Glied
des Vergleiches von den anderen herstammt, dass dagegen beim Vergleich
der verschiedenen Individuen mit den gleichzeitig lebenden alle Glieder
zusammen der Gegenwart angehören. con = zusammen, de = von — her. Man
muss unter den Variationen auseinander halten solche, die sich auf
dauernde Anlagen, also auf den Be- stand und die Beschaffenheit der
Regulationsvorrichtungen beziehen und solche, die nur die Folgen der
Thätigkeit dieser Mechanismen sind. Wenn ein ganz normaler Mensch durch
Mästung fett wird, so ist das Resultat keine Variation von Anlagen.
Wenn dagegen ein Mensch bei demselben Verfahren mager, ein anderer bei
magerer Diät fett bleibt, so beruht dies auf dem Complex ihrer Anlagen.
Nur die Variationen von Anlagen sind echte Variationen und von solchen
allein wird fernerhin die Rede sein. Leider ist die Grenze oft schwer
zu ziehen. Die Ursachen der Variation liegen natürlich zu guter Letzt
in äusseren Einwirkungen. Es können die folgenden Fälle stattfinden.
Die Keimstoffe jedes der Eltern können, von ihrem Zustand in der
elterlichen Furchungszelle an, als der Elter erst ein befruchtetes Ei
war, bis zum Moment der Abstossung aus dem elterlichen Organismus bei
der Begattung, irgend welche indirecten Einwirkungen der Aussenwelt
durch das Mittel des Elterkörpers hindurch erfahren, da ja die
Keimstoffe durch den Stoffwechsel des Elters sicher mit beeinflusst
werden. Beispiele für diesen Fall sind das häufige Kleinbleiben bei den
Kindern der Säufer und Quecksilberarbeiter. Hierher gehören auch
geänderte Ernährungs- und allerlei Krankheits-Einflüsse, ebenso die der
Uebung und Nichtübung von Organen, wenn sich dieselben nicht in der
Weise der Vererbung geltend machen. Veränderung speciell des Klimas und
der son- stigen directen Umgebung haben ebenfalls einen starken
Einfluss, was man aus der Thatsache schliessen kann, dass sie manchmal
die Keimstoffe sogar völlig unfähig zur Be- fruchtung machen. Ein
Beispiel hierfür bieten manche wilden Thiere in unseren zoologischen
Gärten, die sich zwar häufig noch begatten, aber nicht mehr oder erst
nach längeren Zeiträumen wieder befruchten, und zwar wird dies nicht
bloss bei Säugethieren beobachtet, wie sehr oft bei Elefanten, Bären
und Affen, wo immer noch eine verän- derte Gebärmutter eine Rolle
spielen könnte, sondern auch bei Vögeln, z. B. bei Raubvögeln, ebenso
bei wilden Pflanzen, die in Gartenzucht kommen. Eine zweite Ursache von
Variation liegt in dem Ein- fluss der äusseren Umgebung von der Zeit
der Ausstossung der Keimstoffe aus dem elterlichen Körper an bis zum
Zusammentritt des Samenfadens und des Eies. Sehr leicht sieht man diese
Möglichkeit ein z. B. bei Pflanzen, wo der Pollen von einer Blüthe zur
andern durch die Luft oder durch Insecten getragen wird, und bei vielen
Thieren, wo die Keimzellen zuerst in’s Wasser entleert werden, ehe sie
sich treffen. Auch beim Menschen ist eine Beeinflussung dieserart
denkbar, selbst wenn der Samen direct in die Gebärmutter aufgenommen
wird, be- sonders aber, wenn er in der Scheide eine Zeitlang ver-
harrt, oder wenn er gar nur an den Scheideneingang ent- leert wird, ein
Fall, in dem erwiesenermassen, wenn auch sehr selten, doch noch eine
Befruchtung stattfinden kann. Die beiden besprochenen Quellen von
Variationen geben Anlass, ein paar Worte über Keimauslese einzufügen. 3
Betrachten wir einen Tropfen verdünnten Samens unter dem Mikroskop, so
sehen wir, wie sich die meisten Samen- fäden lebhaft schlängelnd hin-
und herbewegen, einige sehr rasch, andere, denen noch Klümpchen von
Protoplasma anhängen, schwerfällig, manche bleiben ruhig oder fangen
später auch an, sich zu bewegen. Allmählich hört das Herumfahren bei
mehr und mehr Samenfäden auf, aber einige wenige halten sehr lange aus
und pendeln noch hin und her, wenn alles herum schon regungslos ist.
Ausser- dem sehen wir aber auch noch Formunterschiede; die Länge der
Köpfe schwankt von 0,003—0,005, die Breite von 0,0018—0,0033 mm; einige
Exemplare sind missge- staltet, stark lichtbrechende Klümpchen
erscheinen hier und da, die augenscheinlich z. Th. zurückgebliebene
oder ge- schädigte Spermatozoenköpfe sind, wie man sie bei gewissen
Hodenaffectionen häufig sieht. Diese Unterschiede können irgendwo an
der Bildungsstätte im Hoden Bei Anfertigung meiner Arbeit über den
Froschhoden hatte ich Gelegenheit, zu beobachten, dass die
Spermatozoen-Köpfe der am Ueber- gang in die Vasa deferentia gelegenen
Bündel manchmal kürzer waren als die der mehr nach dem Innern zu
gelegenen Bündel. als auch auf dem Wege durch die Samenleiter,
Samenblasen und Harn- röhre erworben werden. Jedenfalls ist anzunehmen,
dass diese Unterschiede der Spermatozoen (Samenfäden, Samenthierchen)
oft eine Be- deutung für die Befruchtung haben. Bei der Begattung wird
der Same, der viele Millionen Samenfäden enthält, in die weibliche
Scheide ergossen, z. Th. direct an den Mutter- mund, und seine
Samenthierchen müssen nun in die Gebär- mutter und oft noch weiter bis
in die Tuben (Eileiter) und nahe an den Eierstock hinaufdringen. Bei
diesem Wett- rennen der Samenthierchen werden die am ehesten siegen,
die sich gegen die schädlichen Scheiden-Absonderungen und eventuell
(bei Krankheiten) schädlichen Gebärmutter- und Tubensecrete am besten
erhalten, und welche die grösste Bewegungskraft entwickeln können, um
an dem verhältnissmässig fernen Ziel zuerst anzulangen. Diejenigen
Samenfäden, die zuerst in der Nähe des befruchtungsfähigen Eies
angelangt sind, unterliegen auch wieder einer Auslese, da sie nun durch
die sexuelle Affinität Vgl. Hertwig, O. Die Zelle und die Gewebe. Jena
1892 S. 240. sehr energisch angezogen werden, und da nur ein Samenfaden
normaler Weise in das Ei eindringen kann. Eine ähnliche Auslese wie
unter den Samenfäden findet auch unter den Eiern statt. Der menschliche
Eierstock enthält viele Tausende Eier, von denen zeitweilig nur eines
oder einige frei werden. Schon hier ist die Möglichkeit einer Auslese.
Eine fernere Möglichkeit wird dadurch ge- geben, dass ausser dem grade
abgestossenen Ei noch ältere Eier in dem Genitalschlauch liegen können,
die nun darum concurriren, den Sieger in dem Wettlauf der Samen-
thierchen zuerst zu empfangen. Was wir von thierischen Eiern wissen,
macht es so gut wie gewiss, dass ältere Eier nicht mehr so kräftig
sind, also höchst wahrscheinlich auch nicht mehr eine so ener- gische
Affinität auf den herankommenden Samenfaden aus- üben. Angenommen,
derselbe wäre von beiden Eiern nur wenig verschieden entfernt, so würde
das jüngere stärkere Ei das Samenthierchen dem älteren Ei so zu sagen
vor der Nase wegfischen. Sind zwei oder mehrere Eier gleichzeitig
befruchtet worden, so ist auch hier immer noch die Möglichkeit vor-
handen, dass eine Auslese eintritt in Bezug auf die Fähig- keit, sich
in die Gebärmutterwand einzubetten; bei befruch- teten älteren Eiern
wird das wohl manchmal nicht eintreten. Dies sowie der spätere Kampf
zweier angesiedelter und in der Fortentwickelung begriffener Eier, oder
vielmehr Früchte, um die beste Ernährung durch die Mutter, wobei 3* oft
genug die eine Frucht umkommt, gehört bereits in das Gebiet des
eigentlichen Kampfes um’s Dasein der Individuen. Eine beträchtliche
Quelle von Variationen entspringt ferner aus der Vereinigung der beiden
Keimstoffe bei der Befruchtung. Es ist durchaus ungerechtfertigt,
anzunehmen, dass durch die sexuelle Verschmelzung der beiden Keim-
plasmata immer ein Wesen entstehen müsste, dass in seinen Anlagen genau
die Mitte zwischen den Eltern hält. Es können sich Mischungen ergeben,
die einzelne Anlagen abschwächen oder zerstören, andere dagegen
verstärken. Das stärkere Aehneln der Kinder das eine Mal mehr nach dem
Vater, das andere Mal mehr nach der Mutter, spricht dafür. Ja, es kommt
vor, dass bei Mischung sonst ganz normaler Keimstoffe die
Lebensmöglichkeit direct zerstört wird. Hierfür spricht folgende
Thatsache: Zwei gesunde Gatten bleiben ohne ihr Verschulden
unfruchtbar, sie gehen auseinander und verheirathen sich auf’s Neue mit
je einem anderen Individuum; beide ursprüngliche Gatten bekommen nun
Kinder. Die Untersuchung erweist dabei normalen Bau der Genitalien.
Wenn so starke Aenderungen durch die Mischung der Keimstoffe entstehen
können, so haben wir genügenden Grund, anzunehmen, dass dabei auch ge-
ringere Aenderungen bis herab zu den kleinsten eintreten können. Eine
letzte Abtheilung von Variationen entsteht aus den Einwirkungen der
Umgebung auf das befruchtete Ei und alle späteren Stadien des
neugebildeten Individuums bis zum Ende seiner Gattungsfunctionen. Diese
Ab- theilung zerfällt wieder in Abschnitte, die nach Art der Einflüsse
und Grad der Beeinflussbarkeit des Körpers verschieden sind: Einflüsse
während des Aufenthalts in der Gebärmutter, während der
Säugungsperiode, der Zeit bis zur Pubertät, der Zeit bis zur Vollreife
und der Periode der Reife selbst. Die Art der Ernährung und Ver-
giftung von Mutter und Kind (Armuth, Alkohol), allerlei
Krankheitseinflüsse, Uebung und Nichtübung von Organen und vieles
Andere kann hierbei eine Rolle spielen. Schwierig ist die
Unterscheidung der verschiedenen Variationen je nach ihrem Ursprung.
Besonders die nach Vollendung der Befruchtung bewirkten Variationen
sind speciell beim Menschen wegen der weit verbreiteten Mono- gamie oft
nicht von denen vor und bei der Befruchtung bewirkten zu unterscheiden.
Nur z. B. in dem Fall, wo ein Vater je ein Kind von zwei Frauen hat und
jedes Kind dieselbe ganz charakteristische Eigenthümlichkeit aufweist,
ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass die betr. Eigen- schaft auf
Keimvariation beruht. Diese Wahrscheinlichkeit wird fast Gewissheit,
wenn beide Frauen schon früher von anderen Gatten Kinder ohne diese
Eigenschaft hatten. Weismann hat die Keimesvariationen principiell von
den späteren Variationen trennen wollen, weil seine Hypothese es
verlangte, dass nur Keimesvariationen erblich seien, die späteren,
identisch mit seinen „erworbenen Eigenschaften“, jedoch nicht. Nur
Abänderungen aus den Keimen und ihrerVermischung sollten
überhaupt„Variationen“ heissen. Wie wir schon sahen, ist dies jedoch
noch kein nothwendiges theoretisches Erforderniss, desshalb müssen wir
in weiterem Anbetracht der häufigen Unmöglichkeit der Entstehung einer
Variation nachzuspüren, alle Ver- änderungen von Anlagen als
Variationen bezeichnen, um so mehr, als ja die Nichtvererbung
erworbener Eigenschaften durchaus kein gesichertes Gesetz ist. Noch
einige specielle Arten von Variationen sollen hier erwähnt werden. Der
Rückschlag oder Atavismus ist eine Variation, die bei den betreffenden
Individuen Eigenschaften der Grosseltern, Urgrosseltern und noch
weiter, oft viele Tausende von Generationen entfernter As- cendenten
wiederholt, wobei es sich wohl meistens um den Fortfall später vom Keim
erworbener hemmender Anlagen handelt. Auch ein Theil der „latenten
Vererbung“ kommt nur durch eine Variation zu Stande, die die
betreffende Anlage an ihrem Auftreten verhindert. Welche besonderen
Ursachen jede einzelne Abänderung in Wirklichkeit hat, ist nur in
wenigen Fällen bekannt, wie denn überhaupt die ganze Lehre der
Variabilität noch sehr in Dunkel gehüllt ist. Die Grenzen der
Variabilität sind sehr weit gezogen. Von der krassesten Monstrosität
bis zu den kleinsten indi- viduellen Abänderungen giebt es alle
Uebergänge. Wallace bestimmte nach vielfachen Messungen an
verschiedenen Organen, dass die Variationen in der Grösse vieler Organe
bis zu 10 %, ja 20 % des Mittelwerths nach oben und unten schwanken
können. Dabei zeigt sich, dass jedes Organ und jede Zellgruppe variiren
kann und zwar bis zu einem bestimmten Grade unabhängig von den übrigen
Be- standtheilen des Körpers. Häufig allerdings kommt es vor, dass,
wenn eine bestimmte Abänderung auftritt, eine be- stimmte andere mit
auftritt. Man spricht dann von Correlation der Theile und correlativer
Variation. Ein Beispiel hierfür bilden die secundären
Geschlechtscharaktere, wie die tiefe Stimme und der Bart beim Mann, die
fast stets fehlen, wenn die Hoden nicht entwickelt sind. Die
Sommersprossen der Rothhaarigen und die Taubheit der blauäugigen Katzen
gehören auch hierher. Was die Häufigkeit des Variirens anlangt, so
giebt es in einer Art nicht zwei Individuen, die sich ganz gleich sind.
Bei den Menschen ist dies allbekannt. Auch sehr ähnliche Zwillinge und
sog. Doppelgänger weisen bei ge- nauem Hinsehen stets Verschiedenheiten
auf. Das sind die sog. individuellen Verschiedenheiten Darwin’s. Doch
auch stärkere Variationen sind häufig genug. Wallace fand sehr
beträchtliche Variations-Grade bei 5—10 % der unter- suchten Individuen
vor. Wallace, A. R. Der Darwinismus. Cap. III. S. 117. Die Bedingungen,
welche das häufige Auftreten von Variationen bei einer Rasse begün-
stigen, sind hauptsächlich drei: Starke Individuenzahl der Art,
Verbreitung über ein weites Gebiet mit verschieden- artigen äusseren
Einflüssen und Kreuzung mit verschiede- nen, aber doch nahe verwandten
Rassen. Wallace, a. a. O. Seite 143. Die Vererbbarkeit der Variationen
ist sehr verschieden; manche werden gar nicht vererbt — wie wir schon
sahen, behaupten Weismann und seine Anhänger das von allen noch nach
der Keimvereinigung bewirkten Abänderungen — andere werden mit grosser
Constanz vererbt. Im Grossen und Ganzen steht fest, dass, je länger und
öfter eine Eigenschaft im Lauf der Generationen vererbt wurde, ihr
Wiedererscheinen desto sicherer, und vor je kürzerer Zeit sie
aufgetreten, desto unsicherer ist. Kürzlich aufge- tretene, sehr
beträchtliche Variationen schwanken in der Vererbung ihrer
Beschaffenheit und ihres Grades relativ sehr beträchtlich. Ehe wir die
Variabilität verlassen, noch eine kurze Bemerkung über das Entstehen
neuer Qualitäten aus quan- titativen Abänderungen der alten
Eigenschaften. Der Gang wissenschaftlicher Erkenntniss bewegt sich
fortwährend in der Richtung, Qualitäten in Quantitäten aufzulösen. Man
hofft durch die bisherigen glänzenden Erfolge, dass es gelingen wird,
in Zukunft alle die vielen Qualitäten so in Quanti- täten aufzulösen,
dass nur einige wenige Grundquali- täten übrig bleiben würden. Als
Beispiel, wie es gelungen, frühere sinnfällige Qualitäten in objective
Quantitäten auf- zulösen, seien die Farben erwähnt, wo die einfache Zu-
nahme der Aetherschwingungen die ganze Scala von Roth durch alle
Regenbogenfarben bis Violett entstehen lässt. Die Einheit und dadurch
mögliche quantitative Messbarkeit aller Energieformen, mechanische
Bewegung, Wärme, Licht, Elektrizität, chemische Energie ist die
gesicherte Errungen- schaft unseres Jahrhunderts. Die Auflösung der
Verschie- denheit der Zucker- und Stärkearten in Zahlen-Unterschiede
zusammentretender gleicher Moleküle ist ein Beispiel aus der Chemie. Da
die Organe der Lebewesen ja auch nichts weiter als
chemisch-physikalische Functionsapparate sind, so müssen wir es als
principiell richtig anerkennen, dass aus ihren objectiv quantitativen
Abwandlungen für uns sinn- fällige Qualitäten entstehen können. Dies
zum Verständniss, wie auch aus Häufung von nur dem Grade oder der Menge
nach verschiedenen Eigen- schaften uns als gänzlich neugeartet
erscheinende Eigen- schaften hervorgehen können, wie also trotz
Beobachtung von überwiegend nur quantitativen Variationen doch eine
theoretische Verständnissschwierigkeit für die Entwickelung aller der
vielen Qualitäten der Lebewelt nicht vorliegt, die Schwierigkeit liegt
einfach in unseren mangelhaften Unter- suchungsmethoden. Wie man leicht
ersieht, ist die Variabilität der posi- tive Eckpfeiler jeder
Entwickelungstheorie. Hier liegt noch der ganze Rest des Geheimnisses
der Entwickelung als un- gehobener Schatz. Hier haben wir sowohl für
Ent- wickelung als auch für Rückentwickelung die eigentliche Triebkraft
vor uns, die der Vererbung und dem dritten Factor, den wir noch zu
betrachten haben, dem Kampf um’s Dasein überhaupt erst das Material
liefert. Der Kampf um’s Dasein. Vgl. Ammon, O. Die natürliche Auslese
beim Menschen. Jena, 1893. — Darwin, Ch. Ueber die Entstehung der Arten
durch na- türliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen
im Kampfe um’s Dasein. Deutsch von Carus. VI. Aufl. Stuttgart 1876. Was
geschieht mit den vielen von früher her vererbten und frisch erzeugten
Variationen? Die Besitzer derselben werden durch das fortdauernde
Missverhältniss ihrer Zahl zu den Lebensbedingungen der Umgebung zum
Kampf unter einander und mit der übrigen Natur gedrängt. Selbst-
verständlich siegen hierbei die Besitzer vortheilhafter Varia- tionen
im Grossen und Ganzen über die schlechter Va- riationen, so dass diese
nicht so oft zur Vermehrung kom- men, wodurch, wie wir schon früher
ausführten, die fort- schreitende Anpassung der Wesen an ihre Umgebung
mit- erklärt wird. „Ein Kampf um’s Dasein tritt unvermeidlich ein in
Folge des starken Verhältnisses, in welchem sich alle Or- ganismen zu
vermehren streben. Jedes Wesen, welches während seiner natürlichen
Lebenszeit mehrere Eier oder Samen hervorbringt, muss während einer
Periode seines Lebens oder zu einer gewissen Jahreszeit oder gelegent-
lich einmal in einem Jahre eine Zerstörung erfahren, sonst würde seine
Zahl in Folge der geometrischen Zunahme rasch zu so ausserordentlicher
Grösse anwachsen, dass keine Gegend das Erzeugte zu ernähren im Stande
wäre. Da daher mehr Individuen erzeugt werden, als möglicher Weise
fortbestehen können, so muss in jedem Falle ein Kampf um die Existenz
eintreten, entweder zwischen den Individuen einer Art, oder zwischen
denen verschiedener Arten, oder zwischen ihnen und den äusseren
Lebensbe- dingungen. Es ist die Lehre von Malthus in verstärkter Kraft
auf das gesammte Thier- und Pflanzenreich über- tragen, denn in diesem
Falle ist keine künstliche Ver- mehrung der Nahrungsmittel und keine
vorsichtige Enthal- tung vom Heirathen möglich .... Selbst der Mensch,
welcher sich doch nur langsam vermehrt, verdoppelt seine — Haeckel, E.
Natürliche Schöpfungsgeschichte. VII. Aufl. Berlin 1879. — Hauptmann,
K. a. a. O. Theil V. — Lange, Fr. Alb. Die Arbeiterfrage. VI. Aufl.
Cap. I u. II. Winterthur 1876. — Mal- thus, Th. R. Versuch über das
Bevölkerungsgesetz. Deutsch von Stöpel. Berlin 1879. — Wallace, A. R.
Contributions to the theory of natural selection. II. Aufl. London 1871
und: Der Darwinismus. Deutsch von Brauns. Braunschweig 1891. —
Weismann, Aug. Die Allmacht der Naturzüchtung. Jena 1893. Anzahl in 25
Jahren, und bei so fortschreitender Verviel- fältigung würde die Welt
schon in weniger als tausend Jahren buchstäblich keinen Raum mehr für
seine Nach- kommenschaft haben.“ Darwin, Ch. Entstehung der Arten. S.
85. Die Bevölkerung des deutschen Reichs hat sich in den letzten 75
Jahren verdoppelt. Angenommen, es könnte diese Rate auch weiterhin
bestehen, so würden nach 1200 Jahren über 3 Billionen Menschen auf dem
deutschen Gebiet wohnen, d. h. etwa 5 auf 1 qm, sie könnten also neben
ein- ander gestellt, den gesammten Boden vollkommen bedecken. Da in
früheren Jahrhunderten die Geburtsziffer kaum nied- riger war als
jetzt, so lässt das einen Schluss auf die enorme Zahl von Menschen zu,
die im Kampf um ihre Lebens- und Fortpflanzungsbedingungen
untergegangen sind. Man hat oft im Anschluss an Marx geltend gemacht,
dass die Menschen ein anderes Bevölkerungsgesetz hätten als Pflanzen
und Thiere. Friedrich Albert Lange hat, neben Anderen, dies treffend
widerlegt. Ich verweise auf das fünfte Capitel seiner Arbeiterfrage.
(S. 212 u. ff.) Es findet bei den civilisirten Menschen eben keine
directe Concurrenz um die Lebensbedingungen statt, sondern eine
indirecte in der Form der Bewerbung um oekonomische Nährstellen. Dies
ist aber nur eine Art des später er- wähnten und auch unter Thieren
heimischen Socialkampfes. Da wo sich die verfügbaren Nährstellen
vermindern, so bei Einführung von arbeitsparenden Maschinen, bei Krisen
etc., findet doch ein Kampf um’s Dasein unter denen statt, die in ihren
Nährstellen bleiben wollen, wobei auch im Grossen und Ganzen die
Passendsten siegen. Zum weiteren Verständniss des Kampfes um’s Dasein
und seiner Folge, der Auslese, d. h. dem Überleben nur eines Theils der
erzeugten Keime und zwar der passend- sten, müssen wir etwas näher auf
das Verhältniss der Lebe- wesen zu ihrer Umgebung eingehen. Jeder
Organismus ist Einwirkungen von Seiten der Aussenwelt unterworfen,
denen gegenüber er sich entweder erhält oder nicht. Er erhält sich
dann, wenn durch die äusseren Einwirkungen Änderungen in ihm
hervorgerufen werden, die die Störung ausgleichen, oder mit einem
andern Wort, in ihm sind Regulations- oder Erhaltungs-Mechanis- men
thätig. Sobald die äusseren Einwirkungen nicht mehr in die
Regulationsbreite fallen, wird der Orga- nismus geschädigt, eventuell
bis zur Vernichtung. Hauptmann. K. a. a. O. S. 345—361. Die Summe und
Breite aller dieser Regulations- oder Er- haltungsmechanismen eines
Organismus nennen wir seine Erhaltungskraft. Der Fortpflanzungsprocess,
einschliesslich der Brut- pflege, ist ebenfalls, betrachtet im
Verhältniss zur Aussen- welt, eine Summe von Regulationen, die zusammen
die Fortpflanzungskraft des Individuums ausmachen. Beide zusammen,
Erhaltungs- und Fortpflanzungskraft werden wir schlechtweg seine
Constitutionskraft nennen. Die Einwirkungen der Aussenwelt, soweit sie
sich auf ein Individuum beziehen, will ich in directe Aussen- oder
Extralwirkungen sit venia verbo. und interindividuelle oder Social-
wirkungen theilen, je nachdem sie directe Wirkungen der äusseren Natur
sind, oder mittelbare, durch die anderen Art- oder Rassenindividuen
hindurchgehende. Ein Blitz- schlag z. B., der einen Spaziergänger
ereilt, ist eine Extral- wirkung; gesprochene Worte oder der
Lichtmangel in einer Kellerwohnung, die eine durch eine Handelskrise
verarmte Familie innehat, sind Socialwirkungen. Die Extral- und
Socialwirkungen, die noch in die Regulationsbreite fallen, also
ausgeglichen werden, nennen wir Reize, diejenigen jedoch, die zu stark
für die Regulationen sind und sie schädigen, anstatt sie einfach zur
Thätigkeit zu reizen oder zu üben, nennen wir Schädlichkeiten. Die
Reize zerfallen natürlich auch wieder in Extral- und Socialreize. Ein
Extralreiz z. B. ist der Frost, der mir beim Schlittschuhlaufen die
Füsse kalt macht, ein So- cialreiz die Ohrfeigen, die ein betrunkener
Kutscher von Passanten bekommt, weil er sein Pferd misshandelt. Die
Reize unterscheiden sich sonst noch in die für die Erhaltung
nothwendigen normalen Lebensreize oder Lebensbedin- gungen und in die
anormalen Reize, die den Körper nur gelegentlich treffen und durchaus
nicht für seine Erhaltung nöthig sind, zu denen z. B. sehr starke
Hitze- und Kältegrade, sowie für die meisten Individuen die leichten
Infectionskrank- heiten, der Genuss kleiner Dosen Alkohol etc. gehören.
Auch bei den Schädlichkeiten lassen sich wieder Extral-
schädlichkeiten, wie z. B. Blitzschlag, Schlangenbiss, Sumpf- fieber,
und durch andere Individuen vermittelte Socialschäd- lichkeiten
auseinanderhalten, wie z. B.: Todtschlag, Ver- drängung von der
nöthigen Nahrung, Ansteckung mit Syphilis und Ähnliches. Die Bedeutung
dieser Beziehungen für den Artprocess, also auch für das Leben der
Rassen, wird ersichtlich, wenn wir den Unterschied in der
Reactionsfähigkeit der einzelnen Individuen betrachten, die eine Rasse
zusammensetzen. Diese bieten zahlreiche Variationen in Bezug auf Güte
und Menge ihrer Regulationsmechanismen dar, nicht nur in Bezug auf
einen solchen Mechanismus, sondern auf viele zugleich. Da die
Individuen keine blossen Haufen von Mechanismen sind, sondern ein
centrirtes System derselben, so müssen wir nicht die einzelnen
Variationen betrachten, sondern die Traeger ihrer systematischen
Einordnung in einander, die Varianten. Die Convarianten derselben
Altersklassen haben resul- tirend aus der Summe ihrer variirenden
Regulationen natür- lich auch eine verschiedene Constitutionskraft, von
der stärksten durch zahlreiche Uebergänge bis zur schwächsten. Für jede
Convariante ist also das, was Reiz, und das, was Schädlichkeit ist,
etwas Verschiedenes; was für eine Variante nur ein normaler Lebensreiz
ist, kann für eine zweite schon ein anormaler Reiz, für eine dritte
sogar direct schädlich sein. Nur bei den Schädlichkeiten können wir
eine Reihe unterscheiden, die alle Convarianten, die zufällig Zufall im
Sinne Lange’s gebraucht, vergl. F. A. Lange. Die Arbeitsfrage. S. 82 u.
ff., besonders 84. davon betroffen werden, ausnahmslos in einem
gewissen Grade gleich stark treffen. Ein mörderisches Erdbeben, ein
Ziegelstein, der vom Dache fallend einen Vorbeige- henden tödtet, der
Dolch des Meuchelmörders, der sich in seinem Opfer versieht, sind
Schädlichkeiten, denen keine Constitutionskraft gewachsen ist. Es
erhellt, dass diese zuletzt berührten Schädlichkeiten keine Auslese
(Selections)-Function haben, da die Betroffenen nicht auf Grund irgend
einer sie von den anderen Conva- rianten unterscheidenden Eigenschaft
leiden; wir werden desshalb diese Insulte von den andern absondern
unter dem Namen der nichtwählenden oder non-selectorischen
Schädlichkeiten. Manche nonselectorischen Schädlichkeiten können
selectorische sein, sobald es sich nicht um die Concurrenz der
Individuen, sondern der Stämme oder noch grösserer Verbände unter
einander handelt. Den Rest sämmtlicher anderen äusseren Einwirkungen,
Reize und Schädlichkeiten, die eben einen Unterschied zwischen den
Convarianten auf Grund ihrer Constitutionskraft machen, werden wir
demzufolge die auswählenden, auslesenden oder selectorischen Wir-
kungen nennen, die auch wieder Extral- und Socialwirkungen sein können.
Aus ihrem Verhältniss zu den Convari- anten ergiebt sich der Kampf um’s
Dasein, bestehend aus dem Extral- und Socialkampf. Wir heben zum
zweiten Mal hervor, dass der Kampf um Dasein nicht blos die bewusste,
sondern auch die unbewusste Reaction gegen die selectorischen Wirkungen
einschliesst. Der Extralkampf umfasst das Verhalten der ein- zelnen
Varianten gegenüber allen Factoren der äusseren Natur, die ganz direct
auf sie wirken, ohne Vermittelung anderer Convarianten. Hierher gehören
gewisse Mengen und Grade von Luft, Licht, Wärme, gewisse Krankheiten
etc. Bei Thieren spielt der Extralkampf eine grosse Rolle. Von den
Standvögeln eines Quartiers, erzählt Darwin, werden oft durch starke
Winterkälte nur 20 % übrig gelassen. Ein Theil dieses Kampfes wird von
ihm als extral angenom- men, der andere durch den Streit um das
verminderte Futter als social. Darwin, Ch. Entstehung der Arten. S. 89
u. 90. Der Socialkampf umfasst das Verhalten der ein- zelnen
Convarianten gegenüber den directen Wirkungen anderer Convarianten oder
den durch ihr Verhalten be- dingten oder modificirten Wirkungen der
äusseren Natur. Der Socialkampf spielt unter den Menschen desshalb eine
so enorme Rolle, weil weitaus die meisten Menschen die verschiedenen
Güter zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse nicht selbst herstellen,
sondern im Austausch gegen nur wenige von ihnen producirte
Waarengattungen erwerben, und weil selbst diese Production nur selten
noch ein Einzel-, sondern meist ein durch Arbeitstheilung vielglie-
driger socialer Process ist. Aus dem ganzen Socialkampf der Menschen
lassen sich wieder einzelne Formen herausheben. Der Kampf um den
tauglichen Gatten, die geschlechtliche Zucht- wahl (sexuelle Auslese)
Darwin’s ist eine solche Form. Eine andere ist der oekonomische Kampf,
der um die Erlangung von Gütern und Dienstleistungen gekämpft wird, die
der Befriedigung der Lebensbedürfnisse dienen. Vgl. die Ausführungen F.
A. Lange’s in seiner Arbeiterfrage. S. 89 u. ff. Wieder eine andere
Form ist die des Kampfes gegen Krankheiten, der z. Th. übrigens extral
ist. Diese drei Formen werden uns vor anderen später beschäftigen. Sie
gehen selbstverständlich in einander über. So ist der Kampf um den
Gatten oft ein theilweise oekono- mischer, ebenso der Kampf gegen
Krankheiten. Kehren wir zu unseren Ausgangsbetrachtungen zurück. Der
Kampf um’s Dasein wurde einmal geführt um die Selbst-Erhaltung, sodann
um den tauglichen Gatten und schliesslich um die Erzeugung und
Aufziehung von Kindern. Die Convarianten, welche sich in allen drei
Phasen des Kampfes zugleich in dem oben definirten Sinne be- haupten
können, wollen wir starke Convarianten nennen, die anderen schwache.
Gemäss dieser Bestim- mung ist ein kräftiger, sonst gut veranlagter
Mann, der aus Abneigung gegen das weibliche Geschlecht und gegen Kinder
ohne Nachkommen bleibt, ebenso gut eine schwache Convariante wie ein
herunter gekommener Syphilitiker, der ein Dutzend früh sterbender
Kinder zeugt. Starke Convarianten sind also diejenigen, deren Er-
haltungs- und Fortpflanzungskraft genügend gross ist, um sich bei
durchschnittlichen selectorischen Einwirkungen nicht nur selbst zu
behaupten, sondern auch um Nachkommen zu erzeugen und bis zur
Selbständigkeit zu bringen, die mit ebenso ausreichender potentieller
Constitutionskraft ausge- rüstet sind, Nachkommen, deren Zahl
mindestens den An- theil an der Gesammtzahl der Rasse erreicht, den die
Eltern von ihr ausmachten. Schwache Convarianten dagegen sind
diejenigen, deren Eigen- und Gattungs-Regulationen nicht mehr
ausreichen gegenüber den Störungen, welche die starken Convarianten
noch nicht schädigen, und die desshalb den im vorigen Satz bezeichneten
Erfolg nicht erreichen können, also im Kampf um einen besseren Antheil
an der Rasse unterliegen. Ein Unterscheidungsmerkmal, allerdings nur
für die Vergangenheit, ist demnach der Erfolg. Doch ist derselbe für
eine Generation nur im Grossen und Ganzen zu ver- werthen, da
einestheils starke Convarianten durch nonselec- torische Einflüsse
zerstört werden können, andrerseits der Entartungsprozess schwacher
Convarianten sich durch mehrere Generationen hinziehen kann. Durch
einen Rück- blick, sagen wir einmal von heute auf die Zeit vor tausend
Jahren, können wir uns den Begriff der starken Convarianten etwas
anschaulicher machen. Dieselben würden vor tau- send Jahren einfach in
den directen Vorfahren der noch jetzt lebenden Individuen bestehen, nur
müssen noch die durch übermächtige Einflüsse beseitigten ebenso
kräftigen Convarianten dazu gerechnet werden. Diese Vorfahren be-
sassen eben diejenigen guten Eigenschaften, die das Fort- blühen ihrer
nachkommenden Geschlechter bis in die Gegen- wart hinein bedingten. Die
Unterscheidung starker und schwacher Convarianten vor dem Erfolg oder
Misserfolg, also in allen Stadien vor vollendeter Pflege ihrer Kinder,
ist schwer, oft unmöglich. Es müssten da alle möglichen
Regulations-Apparate auf ihre Zahl und Stärke untersucht werden. Das
ist in exacter Weise bei unserer mangelhaften Kenntniss der
Regulationen einfach nicht durchführbar. Trotzdem ist eine grobe Un-
terscheidung meist möglich. Der übermässig lange, dünne, magere
flachbrüstige und kurzathmige Jüngling ist ganz sicher keine starke
Convariante, ebenso wenig der hereditär Syphilitische, der stark
belastete Psychopath, das scrofulöse Kind, das Weib mit kindlichen
Geschlechtsorganen u. s. w. Andrerseits sieht man wahre Musterexemplare
geistig und körperlich normal veranlagter Menschen, bei denen auch eine
erfolgreiche Thätigkeit im Dienste der Gattung höchst wahrscheinlich
ist. Also das erste und das letzte Drittel in der Stufen- leiter der
starken und schwachen Convarianten könnten wir vielleicht schon
abschätzen, nur nach der Mitte zu wird die Sache schwieriger. Da giebt
es auch trotz der verdienst- vollen Untersuchungen der Militärärzte für
das männliche Geschlecht und der Lebensversicherungsgesellschaften noch
sehr viel zu arbeiten. In dem Vorhergehenden haben wir den Kampf um’s
Dasein der Individuen einer Rasse betrachtet, d. h. von Zellstaaten.
Bei der Keimauslese lernten wir einen Kampf um’s Dasein zwischen der
nächst niedrigen Organisations- stufe kennen, nämlich zwischen Zellen.
Möglicherweise lehrt uns die Zukunft noch einmal etwas über den Kampf
der Elemente, deren Wachsthum und Vermehrung erst wieder die Zelle
bilden. Aber auch über dem einen Zellenstaat repraesentiren- den
Individuum giebt es noch Organisationstufen des Lebens, das sind
Stämme, Völker und Rassen. Vgl. Schäffle, A. Bau und Leben des socialen
Körpers. Tübingen 1881. Auch unter ihnen giebt es starke und schwache,
die durch einen Kampf um’s Dasein unter einander zur besseren
Entfaltung oder zum Verfall kommen. Bei diesem Societätenkampf mussten
einige oder viele Mitglieder ausser den Eigenschaften, die im Kampf
um’s Dasein der Individuen nützlich waren, noch andere Eigenschaften
besitzen, die zum Siege der höheren Gemeinschaft nöthig waren, wie z.
B. aufopfern- den Heldenmuth, Kameradschaftlichkeit, Mannentreue, über-
haupt Altruismus. Die Gemeinschaften, unter denen viele Individuen
solcher Art waren, hatten mehr Aussicht, im Kampf um’s Dasein zu
siegen, als andere. Die Societäten sind nicht nur unter den Menschen zu
Hause, sondern auch bei anderen geselligen Thieren, wie z. B. Ameisen,
Bienen, Termiten. Wir haben demgemäss im Ganzen drei Formen der 4
Auslese, die für unsere Ausführungen in Betracht kommen: die
Keimauslese, die Individuen-Auslese und die Societäten- Auslese. Es ist
wohl kaum nöthig, darauf aufmerksam zu machen, dass der Wettbewerb
unter den Rassen nicht völlig zu- sammenfällt mit dem der Societäten.
Die Individuen-Aus- lese spielt dabei auch noch eine Rolle. Denn die
Rassen sind nur zum Theil wirklich organisirte Gemeinwesen. In sehr
fernen Zeiten mögen sie allerdings oft relativ ge- schlossene
Gemeinwesen gebildet haben, allein bereits die alten indogermanischen
Urstämme, auch die Urgermanen, scheinen Mischrassen gewesen zu sein;
noch viel mehr trifft dies zu bei den heutigen staatlich organisirten
Völkern, die complicirte Rassengemische vorstellen. Im deutsch-
französischen Kriege 1870 kämpfte nicht schlechtweg eine germanische
mit einer keltoromanischen Rasse, sondern mannigfach zusammengesetzte
Rassengemische. Auf Seite der Franzosen waren es theilweise
verschweisste Kelten, Romanen, Germanen, Iberer und Ligurer, auf Seite
der Deutschen Germanen, Kelten, Slaven, Littauer und Ro- manen. Nur
dominirte bei den Franzosen das keltische, bei den Deutschen das
germanischen Element soweit, dass allerdings die Entscheidung in diesem
Kampf der Völker auch Wichtigkeit hatte für den Erfolg der beiden
Haupt- rassen. Innerhalb der beiden Völker selbst kämpfen natür- lich
die einzelnen Rassen mit einander in Form der In- dividuen-Auslese.
Hierauf hat in sehr beachtenswerther Weise kürzlich Ammon die
Aufmerksamkeit gelenkt: Vgl. Ammon, Otto. Die natürliche Aus- lese beim
Menschen. Jena 1893. Bedeutung der drei Entwickelungs-Factoren.
Überblicken wir noch einmal die Herleitungen dieses Capitels, so
erhellt daraus deutlich die blosse regulative Function des Kampfes um’s
Dasein für die Erhaltung und Entwickelung der Lebewesen, also auch
unserer Rassen. Immer erst muss ihm die in ihrem Entstehen noch so ge-
heimnissvolle Variation das entgegenwachsende Material unterbreiten.
ehe er seine Auslese aus ihm treffen kann. Die starken Convarianten
müssen erst wirklich entstanden sein, ehe der Kampf um’s Dasein sie vor
der Mischung mit den schwachen bewahren, und die Vererbung ihre guten
Eigenschaften auf den Nachwuchs übertragen kann. Also an der directen
Bewirkung von starken Variationen ist der Kampf um’s Dasein in einer
Generation nicht betheiligt, und in sofern könnte es gestattet sein,
ihn ein blosses negatives Princip zu nennen. Aber wir müssen uns doch
dabei bewusst bleiben, dass diese Bezeichnung nur zulässig ist, so
lange es sich um die Wirkung des Kampfes auf nur eine Generation
handelt ohne Rücksicht auf die nächste. Denn sobald wir die folgende
Generation mit betrachten, also den Kampf um’s Dasein mehr in seiner
Gesammterscheinung auffassen, springt sein regulativer Charakter sofort
in die Augen. Da- durch nämlich, dass er in einer Generation die
schwachen Convarianten vermindert, bewirkt er, dass die sexuellen Ver-
bindungen öfter, als ohne ihn, unter starken Convarianten statt-
finden. Oder mit anderen Worten, wenn unter den grade er- zeugten
Convarianten ein bestimmter Procentsatz starke sind, so vermehrt er
diesen Procentsatz der starken bis zur Zeit der Fortpflanzung, so dass
dann kraft der Vererbung relativ mehr starke wieder erzeugt werden, als
sonst, ohne Kampf um’s Dasein, also bei Mittbetheiligung der schwachen
Convarianten an der Fortpflanzung, entstanden wären. Der Kampf um’s
Dasein bewirkt demnach, kurz ge- sprochen, dass die Zeugenden
durchschnittlich stärkere Con- varianten sind als die Altersklassen,
aus denen sie hervorge- gangen sind, und dass demnach bei der
Fortpflanzung die Durch- schnitts-Stärke der Devarianten eine höhere
ist als ohne ihn. 4* Je mehr die zeugenden Convarianten die Neigung
hatten, schlechtere Devarianten hervorzubringen, desto mehr musste der
Kampf um’s Dasein die letzteren vernichten, wenn die Art auf ihrer Höhe
bleiben sollte. Andererseits je mehr gute Devarianten die zeugenden
Individuen hervorbrachten, desto weniger brauchten ausgemerzt zu
werden, wenn die Art erhalten bleiben sollte, oder falls doch gleich
viele wie sonst durch schärfere selectorische Einflüsse ausgemerzt
wurden, desto rascher hob sich die Art auf eine höhere
Entwickelungsstufe. Wenn die erzeugten Devarianten durchschnittlich
schwächer waren als ihre Eltern, was wohl meistens in der Natur
zutrifft, so war der Kampf um’s Dasein unumgäng- lich nothwendig, um
die Art auf ihrer Höhe zu erhalten. Es wären sonst in der nächsten
Generation die Devarianten noch schlechter ausgefallen. Waren die
erzeugten Deva- rianten dagegen durchschnittlich stärker als ihre
Eltern, so war der Kampf um’s Dasein nicht unbedingt nötig, um die Art
auf ihrer Höhe zu erhalten, sondern er hatte dann nur eine
Zeitfunction, d. h. beschleunigte die Entwicklung der Art und zwar um
so mehr, je schärfer er auftrat. Dass in Bezug auf einzelne Charaktere
der Kampf um’s Dasein nur eine beschleunigende, oft überhaupt keine
wesentliche Rolle gespielt hat, gesteht auch Darwin zu: „Es lässt sich
auch kaum daran zweifeln, dass die Neigung in einer und derselben Art
und Weise zu variiren, häufig so stark gewesen ist, dass alle
Individuen derselben Species ohne Hilfe irgend einer Form von Zuchtwahl
ähnlich mo- dificirt worden sind.“Darwin. Entstehung der Arten. Deutsch
von Carus. S. 113 u. 114. Wir werden später, an einer Stelle, wo es uns
mehr interessiren wird, noch auf dies ausserordentlich wichtige
Wechselverhältniss zwischen Richtung des Variirens, Grösse der
Ausmerzung im Kampf um’s Dasein und Grad der Erhaltung, bezw. Tempo des
Fortschritts der Art, zurück- kommen, und bei der Gelegenheit dann
zugleich die Folgen der Panmixie besprechen, wie Weismann die Aufhebung
des Kampfes um’s Dasein in Bezug auf eine oder mehrere Eigenschaften
der Art-Individuen genannt hat. 2. Capitel. Die Erhaltung und
Vermehrung der Zahl. Geburten- und Sterbeziffer. Höchste und
niedrigste. Geburtenüber- schuss. Schädlichkeiten und
Constitutionskraft. Contraselection: Kriege, präventiver
Geschlechtsverkehr, künstliche Fehlgeburt. — Sinkende Rassen.
Franzosen. Geburtenprävention als Ursache. Möglichkeiten der Abhülfe.
Yankees. Amerikanische Juden. — Aufsteigende Rassen. Westarier,
Europäische Juden. Germanen. Engländer, Deutsche und Skandinavier.
Europäische Sprachen. Deutsche im Reich, in der Schweiz, in
Oesterreich-Ungarn und anderen Nachbarländern. Geburten- und
Sterbeziffer. Zur dauernden Erhaltung einer Rasse gehört zu aller- erst
die Erhaltung der Zahl ihrer Individuen. Je kleiner eine Rasse ist,
desto gefährdeter ist ihr Bestand, beson- ders wenn sie zu einem
wirthschaftlichen Gemeinwesen or- ganisirt ist. Feindliche stärkere
Nachbarn, häufige Ver- mischung mit Fremden, mehr Gelegenheit zur
Inzucht, mangelhafte Möglichkeit der Productionsgliederung und da-
durch bewirkte verhältnissmässige Armuth, das sind alles Momente, die
sich als ungünstige Lebensbedingungen einer kleinen Rasse erweisen
können. Reste niedergehender Rassen haben sich daher auch nur in
relativ abgeschlos- senen Orten, Inseln, Halbinseln, Gebirgsgegenden
halten können und sind auch dort mit völliger Einschmelzung bedroht. Es
ist desshalb von der elementarsten Bedeutung für eine Rasse, dass ihre
Zahl sich womöglich vermehrt oder wenigstens auf ihrer Höhe erhält.
Dies kann nur dadurch geschehen, dass im Durchschnitt der Generationen
die Ge- burtenziffer der Sterbeziffer mindestens gleich kommt. Das
beste Verhältniss wäre eine möglichst hohe Geburten- und möglichst
niedere Sterberate. Eine hohe Geburtenrate hat zur Vorbedingung erstens
eine beträchtliche Eheziffer, zweitens eine grosse physio- logische
Fruchtbarkeit, d. h. körperliche Fähigkeit der Männer und Frauen, viele
Kinder zu zeugen, und der Frauen, sie zu gebären, und drittens eine
möglichst ge- ringe Geburten-Praevention. Letztere besteht sowohl in
geschlechtlicher Enthaltsamkeit und in willkürlichem Ver- hindern der
Befruchtung beim Geschlechtsacte als in Töd- tung der Leibesfrucht. Die
thatsächliche Geburtenziffer eines Volkes resultirt aus dem Zusammen-
bezw. Entgegen- wirken dieser drei Factoren. Die Rassenhygiene fordert
allein in Bezug auf die Er- haltung der Zahl keine Begrenzung der
Geburtenrate nach ihren höheren Werthen zu, wenn dies auch, wie wir
später sehen werden, aus anderen rassenhygienischen Gründen nothwendig
erscheint, wohl aber nach unten. Hier bildet die Sterblichkeitsziffer
die absolute Grenze, unter welche die Geburtenrate selbstverständlich
nicht sinken darf. Die niedrigste bekannte Sterbeziffer für eine
grössere Anzahl Menschen ist etwa 17 ‰. d. h. von je tausend der wirk-
lichen Bevölkerung starben in einem Jahr 17.Die Sterblichkeit Norwegens
von 1871—1881 ohne die Todt- geborenen; die der stationär gedachten
Bevölkerung betrug 20 ‰. Noch nie- drigere Ziffern wurden nur
stellenweise, so von Farr in Theilen von England beobachtet. Zwanzig
englische Di- stricte wiesen in den Jahren 1847 bis 1871, also in 24
Jahren, eine Sterblichkeit der wirklichen Bevölkerung von nur 15 bis 17
‰ auf.Max Rubner, Lehrbuch der Hygiene. Leipzig und Wien. 1890. S. 5.
Für die nächste Zukunft dürfen wir bedeutend niedri- gere Werthe kaum
erwarten, also bleibt vorläufig eine Sterberate von 17 ‰ das im Bereich
der Möglichkeit Lie- gende und die gleichhohe Geburtenrate das
niedrigst er- laupte Maass derselben, sobald diese Sterberate erreicht
ist. Die Sterblichkeit resultirt aus zwei entgegengesetzten Factoren:
der Constitutionskraft der Individuen und den auf sie einwirkenden
äusseren Schädlichkeiten. Ein Abfallen der Sterblichkeit kann sowohl
durch eine Verbesserung der Constitution, als durch eine Verminderung
der äusseren Schädlichkeiten hervorgebracht werden, ja, es ist denkbar,
dass selbst bei sinkender Constitutionskraft die Sterberate ab- nimmt,
wenn nämlich die äusseren Schädlichkeiten noch stärker abnehmen als die
Constitutionskraft. An und für sich kann man einer Sterberate natürlich
nicht ansehen, wie gross ihre beiden Componenten sind. Wir sind dazu
auf die Beobachtung einer Reihe von kör- perlichen und geistigen
Qualitäten der Individuen ange- wiesen, die uns ohnehin später
beschäftigen werden. Wie es für die Geburtsrate ein rassenhygienisches
Minimum giebt, so für die Sterberate ein Maximum, über das sie nicht
steigen darf. Dieses Maximum ist durch die höchstmögliche Geburtsrate
gegeben. Als solche kann nach der Beobachtung ca. 58 ‰ gelten.Ratzel,
Fr. Anthropogeographie. II. Theil. Stuttgart 1891 S. 165. In Europa
steht Russland mit 49 ‰ an der Spitze. So hohe Sterberaten dürften
indessen kaum vorkommen, wenn man Zeiten starker Epidemien und
verheerender Kriege ausnimmt. Doch sind Mortalitäten von 53 ‰
beobachtet worden.Ratzel, a. a. O. S. 165. Die höchste Sterblichkeit in
Europa hat Ungarn, nämlich 41 ‰. Am besten erscheint auf den ersten
Blick eine sehr beträchtliche Geburten- und sehr geringe Sterbeziffer.
Die materielle Grundlage für die daraus resultirende starke
Volksvermehrung ist aber in den seltensten Fällen zu schaffen, die
Eröffnung neuer Nährstellen ist ein gar zu mühsames Geschäft. Wenn
daher die Geburtenziffer in ein beträchtliches Missverhältniss zur
oekonomischen Ent- wickelung kommt, ist die Folge der gesteigerten
Liebes- müh’ doch nur eine Erhöhung der Sterblichkeit. Dieser
Zusammenhang zwischen häufiger Kindererzeugung und starker Mortalität
ist eine statistische Trivialität. Allein der ursächliche Zusammenhang
ist auch umgekehrt, eine grössere Sterblichkeit, besonders der Kinder,
bewirkt eine grössere Geburtenziffer, und zwar im Allgemeinen, weil ein
frei gewordener Platz eine neue Nährstelle bedeutet, im Speciellen
hauptsächlich wohl wegen Abkürzungs der Säu- gungsperiode, während
welcher die Regel der Frauen so gut wie stets aufgehoben und eine
Befruchtung relativ selten ist.Vgl. Geissler, A. Ueber den Einfluss der
Säuglingssterblich- keit auf die eheliche Fruchtbarkeit. Zeitschr. d.
k. sächs. statist. Bu- reaus. XXXI. Jahrg. 1885. Da die Forderung eines
höchstmöglichen Geburten- überschusses geheftet ist an den möglichst
raschen oekono- mischen Fortschritt eines Volks, d. h. an die
möglichste Erweiterung des Spielraums der Lebensbedingungen, so ist,
wenn dieser gegeben, damit auch die zulässige Höhe des
Geburten-Ueberschusses gegeben. Also die Forderung einer Vermehrung der
Zahl einer Rasse ist zu allererst eine wirthschaftliche Frage. Ist die
wirthschaftliche Zulässigkeit eines bestimmten Geburten-Ueberschusses
da, so fragt sich, soll er angestrebt werden durch die Differenz
zwischen vielen Geburten und vielen Todesfällen, oder wenigen Ge-
burten und wenigen Todesfällen. Ein Geburtenüberschuss von 10 ‰ kann
ebenso gut entstehen, wenn Geburtenrate 45 und Sterberate 35 ‰, als
wenn sie 30, bezw. 20 ‰ betragen. Vom Standpunkt der blossen Vermehrung
der Zahl könnte man denken, das sei gleichgültig. Allein dem ist nicht
so. Denn die im ersten Fall mehrerzeugten 15 ‰, die nutzlos geboren
werden und sterben, bedeuten eine enorme Ausgabe an Kraft für die
betreffende Rasse und vermindern ihre Widerstandskraft im Kampf um’s
Dasein gegen andere sonst gleiche Rassen, die weniger Geburten und
weniger Todesfälle haben. Ein zweiter Punkt, der zu bedenken ist,
betrifft die Qualität der Kinder. Bei erhöhter Geburtenziffer sollte
man denken, steigt durch Vermehrung der Ehen und ihrer Kinderzahl der
Betrag der Variation, also die Möglichkeit der Erzeugung guter
Varianten, die dann durch ihren Sieg in dem scharfen Kampf um’s Dasein
die Qualität der Rasse verbessern würden, was bei gleichen Lebensbedin-
dungen gleichbedeutend wäre mit einer grösseren Beherr- schung der
Natur, also einer Vermehrung der Individuen- zahl der Rasse. Für diese
Hoffnung wäre ein Anhalt ge- geben, wenn es sich erstens erweisen
liesse, dass bei Ver- mehrung der Ehen die neuen Ehen von gleich
tüchtigen Gatten als bei den ersten Ehen geschlossen würden, was sicher
nur zum kleinsten Theile zutrifft. Zweitens müsste bewiesen werden,
dass die Constitutionskraft der später in einer Ehe geborenen Kinder,
also der höhern Nummern in der Geburten-Reihenfolge, ansteigt oder
mindestens gleich bleibt. Genau das Gegentheil ist aber richtig.
GeisslerGeissler, Arthur. Ueber den Einfluss der Säuglingssterb-
lichkeit auf die eheliche Fruchtbarkeit. Zeitschr. des k. sächs.
statist. Bureaus. 31. Jahrgang 1885. Dresden. S. 30. hat 26429 Geburten
in 5236 Ehen von Mitgliedern säch- sischer Knappschaftskassen daraufhin
untersucht und fest- gestellt, wieviel im ersten Lebensjahr Verstorbene
auf 100 Geborene der aufeinander folgenden Geburtennummern kommen.
Mangelhaft ist an dieser sonst vortrefflichen Statistik nur, dass ein
Theil der Todtgeborenen und die Kinder aus Ehen mit nur ein oder zwei
Kindern nicht mit eingeschlossen wurden. Auf 100 Geborene kamen
Verstorbene im 1. Lebensjahr: beim 1. Kind 22,9 „ 2. „ 20,4 „ 3. „ 21,2
„ 4. „ 23,2 „ 5. „ 26,3 „ 6. „ 28,9 beim 7. Kind 31,1 „ 8. „ 33,2 „ 9.
„ 36,1 „ 10. „ 41,3 „ 11. „ 51,4 „ 12. „ 59,7 Mittel: 24,6. Die
günstigste Vitalität zeigen also die ersten, bezw. zweiten bis vierten
Kinder, dann fällt sie unaufhaltsam bis zu sehr geringen Werthen ab.
Ähnliches ergeben die Mortalitätsziffern von 100 Ge- borenen bis zum
Alter von 0,09 Jahren, also etwas über einen Monat: beim 1. Kind 9,5 „
2. „ 7,2 „ 3. „ 7,5 „ 4. „ 7,3 „ 5. „ 8,4 „ 6. „ 9,2 beim 7. Kind 10,0
„ 8. „ 11,5 „ 9. „ 12,0 „ 10. „ 14,7 „ 11. „ 16,5 „ 12. „ 18,2 Mittel:
8,6. Die günstigste Vitalität fällt auch hier auf das zweite bis vierte
Kind. Das Zustandekommen des gleichen Geburtenüberschusses durch allzu
grosse absolute Beträge der Geburten- und Sterbeziffer hat also nur
Nachtheile gegenüber der Ent- stehung durch kleinere Beträge. Wie weit
diese Beträge heruntergehen können, ohne die Qualität der Rasse zu ge-
fährden, werden wir später sehen. Versuchen wir nun, diese allgemeine
Skizze in unsere im vorigen Capitel hergeleiteten Begriffe einzuordnen.
Dass ein Geburtenüberschuss überhaupt zu Stande kommt, dazu gehört, wie
wir sahen, eine Erweiterung der Herrschaft der betreffenden Rasse über
die sie umgebenden Bedingungen. Dies kann in zwei Weisen zu Stande
kommen, durch Verminderung von Schädlichkeiten und durch Ver- mehrung
der durchschnittlichen Constitutionkraft. Die Her- absetzung der
äusseren Schädlichkeiten in der Umgebung der Rasse und, mittelbar durch
die Umgebung bedingt, der inneren Schädlichkeiten, kann man sich auf
zwei Arten ent- standen denken, durch die directe Milderung der Natur-
einflüsse ohne Zuthun der Menschen und durch die mensch- lichen
Arbeitsproducte früherer Generationen. Milderung der directen
Natureinflüsse trat z. B. für die Bewohner der nördlichen Hemisphäre
ein, als die Eiszeit schwand, oder fand statt, wenn ein Volk in ein
zuträglicheres Klima wanderte. Die Aufhäufung menschlicher
Arbeitsproducte, geistiger und materieller Art, hat in historischer
Zeit eine bedeutend grössere Rolle gespielt. Wir stehen in unendlich
Vielem auf den Schultern unserer Vorfahren durch ihre erziehe- rische,
wissenschaftliche und künstlerische Arbeit. Die gegen früher enorm
gesteigerte Productivität der mensch- lichen Arbeit, die bessere
Kranken- und Gesundheitspflege, die bessere Erziehung sind Dinge, deren
Bestehen bei uns wir keineswegs durch die gesteigerte Gehirnanlage
unserer modernen Generation zu erklären brauchen, son- dern die sicher
zum grossen Theil einfach auf Anhäufung und Aufbewahrung der geistigen
und materiellen Kultur- arbeit unserer Vorfahren und einer durch
bessere Erziehung gesteigerten Übung unserer Gehirnlage beruhen. Die
andere Möglichkeit der Ausbreitung einer Rasse über ihre Umgebung
besteht in einer Vermehrung der durchschnittlichen Constitutionskraft
ihrer Individuen. Wenn die Regulationen stärker werden, können neue
Plätze in der Natur, deren Occupirung bisher wegen der Schädlich- keit
der von ihnen ausgehenden Einflüsse nicht durchführ- bar war,
ausgefüllt werden. Beide Factoren wirken in der Richtung der Vermehrung
einer Rasse; je stärker jeder von ihnen, desto rascher die Vermehrung.
In Rücksicht auf die Vervollkommnung der Rasse jedoch ist die Stärke
der beiden Factoren durchaus nicht bedeutungslos. Dieses Verhältniss,
sowie überhaupt die Erhöhung der Constitutionskraft, die, wie wir im
vorigen Capitel sahen, an das Auftreten einer bestimmten Menge
stärkerer Devarianten und einer dem Auftreten schwächerer Devarianten
entsprechenden Ausjätung im Kampf um’s Dasein gebunden ist, sollen im
nächsten Capitel eine ge- nauere Besprechung erfahren, da sie im
engsten Zusammen- hang mit der Vervollkommnung des Rassentypus stehen.
Die Betrachtung des anderen Factors, der Umgebungs- Einflüsse, der
selectorischen und der nonselectorischen, in Bezug auf ihre Wirkung auf
die Mitgliederzahl einer Rasse gehört zum grössten Theil in das Gebiet
der Naturwissen- schaft und der Oekonomie. Wir wollen hier an dieser
Stelle nur zwei dieser Einflüsse kurz erwähnen. Beide haben das
Gemeinsame, dass sie nicht nur die Zahl be- schränken, sondern dass sie
hauptsächlich die Zahl der starken Convarianten beschränken, also
contraselectorisch wirken, ein Grund, uns später mit ihrer Bedeutung
noch etwas eingehender zu befassen.Contraselectorische Einflüsse sind
ausser von Darwin und Wallace besonders auch von Haeckel gebührend
gewürdigt worden. Vgl. Na- türliche Schöpfungsgeschichte. VII. Aufl.
Berlin 1879. S. 154 u. ff. Das erste dieser Momente bilden die Kriege,
die eine Rasse oder überhaupt eine Societät führt. Hierbei werden eine
Anzahl der stärksten Convarianten der betreff. So- cietät
herausgenommen und neben einigen selectorischen sehr mächtigen
nonselectorischen Einflüssen ausgesetzt, die sie stark vermindern.
Diese temporäre Verminderung hatte durch die Erwerbung neuen Bodens
oder neuer Absatz- gebiete oft die Folge, dass das siegende Volk seine
Zahl nicht nur rasch wiederersetzte, sondern noch stark ver- mehrte.
Der Krieg war also eines der Mittel im Kampf um’s Dasein der
Societäten, wenn auch eines der zwei- schneidigsten, da er die Summe
der starken Convarianten herabsetzte. In älteren Zeiten fand unter den
zum Kampf aus- ersehenen stärksten Convarianten noch eine gewisse Aus-
lese insofern statt, als beim Kampfe ohne Fernwaffen die- jenigen am
ehesten verschont blieben, die die Stärksten, Gewandtesten und
Schlauesten waren. Eine weitere Aus- lese kam häufig dadurch zu Stande,
dass Söldnerheere kämpften. Diese Söldner waren oft (Armanjaks, Lands-
knechte) zum grossen Theil zusammengelaufenes Gesindel, das aus
Rohheit, Unstätheit, oder weil es im Leben Schiff- bruch gelitten
hatte, der Werbetrommel folgte. Die Söldner hatten also oft
Eigenschaften, die sie als Gatten und Väter zu schlechten Convarianten
gemacht hätten. Wenn so zu- sammengesetzte Heere decimirt wurden, so
hatte die Mensch- heit einen directen Nutzen davon, und es ist sehr zu
ver- muthen, dass Ausjätung der Söldner stark zur Milderung der Sitten
beigetragen hat. Im Grossen und Ganzen re- präsentirten in früheren
Zeiten die heimziehenden Schaaren doch wohl als Convarianten einen
höheren Stärkegrad, als die ausziehenden ihn gehabt hatten. Allein
heute bei unserem ausgedehnten Fernkampf tritt auch dieser geringe
selectorische Factor noch weiter zurück. Wenn heute in einer Schlacht
20000 Mann fallen, so stehen diese im Durchschnitt des Stärkegrades
wohl kaum unter denen, die lebend davon gekommen sind, im Gegentheil,
viele der stärksten Convarianten, wie die Of- fiziere, leiden noch mehr
als die Mannschaften, weil sie den Kugeln häufiger die aufrechte Figur
darbieten müssen. Haushofer giebt in seiner Statistik die Mortalität
auf deutscher Seite im Kriege 1870/71 an für die Generäle auf 46 ‰
Stabsoffiziere „ 105 „ Hauptleute, Rittmeister „ 86 „ Lieutenants „ 89
„ Unteroffiziere und Mannschaften „ 45 „ Dazu kommt, dass heute keine
Söldnerheere mehr, sondern bei der allgemeinen Wehrpflicht Volksheere
kämpfen. Die Ausjätung des Söldnercharakters wird von dem modernen
Krieg nicht mehr oder nur in sehr ge- ringem Grade vollzogen. Eher
wirkten früher noch die Epidemien, die oft beim Kriege ausbrachen, als
ein selec- torisches Moment. Doch auch diese werden seltener. Alles in
allem haben, wenn der Krieg beendet ist, die beiden kriegführenden
Völker an ihrem Bestand von starken Convarianten ganz erhebliche
Einbusse erlitten. Aber da- mit noch nicht genug. Die Zurückgekehrten
haben oft noch an manchen Uebeln zu leiden, die sie im Felde er-
warben, oder sie haben ihre oekonomischen Stellen ver loren, so dass
auch hieraus wieder künstlich geschaffene Benachtheiligungen im Kampfe
um’s Dasein entspringen. Ferner werden die Kinder der Gefallenen, die
gemäss der Vererbung auch wieder stärkere Convarianten darstellen als
die übrigen Kinder, oft genug durch den Verlust ihrer Ernährer und
Erzieher ganz bedeutend im Kampf um’s Dasein behindert. Der moderne
Krieg ist demnach, ganz abgesehen von seinen Brutalitäten, unter den
Mitteln, die ein Volk zur Vermehrung seiner Zahl ergreifen kann,
thunlichst zu ver- meiden, da er mit der Hauptforderung der
Rassenhygiene, der Erhaltung der Constitutionskraft, im Widerstreit
steht. Allerdings wird er wohl manchmal im Kampf um’s Dasein der
Societäten nicht zu umgehen sein. Das zweite Moment ist der praeventive
Geschlechts- verkehr und der künstliche Abortus (Fehlgeburt), die wir
beide zusammen Geburten-Praevention genannt haben. Der praeventive
Geschlechtsverkehr mit der Folge der faculta- tiven Sterilität oder der
künstlichen Unfruchtbarkeit um- fasst alle künstlichen Veranstaltungen
oder Unterlassungen beim Begattungsact, die eine Befruchtung verhindern
können. Beides, praeventiver Geschlechtsverkehr und Abortus sind nicht
nur bei NaturvölkernPloss, Das Weib. Leipzig 1891. III. Aufl sondern
auch bei den civili- sirtesten Völkern heimisch, wie unter den
Nordamerikanern, den Franzosen, den siebenbürger Sachsen und anderen
Völkern. Neuerdings greifen sie auch in England, in der Schweiz und in
Deutschland um sich. Beide Factoren vermindern natürlich ganz
unmittelbar die mögliche Bevölkerungszunahme. Auch sie bewirken grade
wie der Krieg hauptsächlich einen Ausfall starker Convarianten, denn im
Allgemeinen neigen zur Geburten- Praevention grade die Wohlhabenden am
meisten, unter denen ja ein grosser Theil der Sieger im oekonomischen
Kampf stecken. Auch bei den Aermeren ist es wieder der Intelligentere,
der Nüchterne, der sich besser und aus- dauernder zu beherrschen weiss,
welcher am erfolgreichsten die Praevention betreibt. Dass hierbei ein
klein wenig Ausmerzung von Gatten mit rudimentären Elterninstincten
stattfindet, mag man zugestehen; es wird nach meiner Er- fahrung als
Arzt wenig genug sein. Wer den Mechanis- mus erfährt, lässt selten
wieder von der Praxis, und der Gebildete erfährt ihn am ehesten. Der
Präventiv-Verkehr hat also in seinem Gefolge nicht nur eine
Verringerung der Zunahmetendenz, sondern wirkt nebenher noch schädigend
auf die durchschnittliche Constitutionskraft der nächsten Generation,
gehört also ebenfalls der Contraselection an. Recapituliren wir zum
Schluss noch einmal die allge- meinen Bedingungen, die der Vermehrung
einer Rasse am günstigsten sind. Diese Bedingungen sind: erstens
Verminderung der extralen und socialen Schädlichkeiten, besonders
contra- selectorischer wie Kriege, blutige Religionsverfolgungen,
Revolutionen, Geburtenpraevention, und zweitens Steigerung der
durchschnittlichen Constitutionskraft. Sobald durch das Verhältniss
dieser Momente der Geburtenüberschuss be- stimmt ist, liegt es im
Interesse der Rasse, dass er bei wenig Todesfällen und dem entsprechend
wenig Geburten zu Stande kommt. Da die weitere Betrachtung uns bereits
zu sehr in dasselbe Gebiet führen würde, das wir bei Besprechung der
Vervollkommnung des Typus betreten müssen, so sei auf das nächste
Capitel verwiesen. Hier soll nur noch dar- gelegt werden, wie sich in
der letzten Zeit unsere besten Culturrassen in Bezug auf die Vermehrung
ihrer Zahl ver- halten haben, da dies ja einen Schluss auf Sieg oder
Unter- liegen im Kampf um’s Dasein mit anderen Rassen und auf eine
eventuelle durchschnittliche Verbesserung der ge- sammten menschlichen
Rasse zulässt. Letztere wird um so rascher fortschreiten, je mehr sich
der Antheil der Cultur- rassen auf Kosten des Antheils der niedrigeren
Rassen vergrössert. Sinkende Rassen. Franzosen, Yankees. Ein Bild des
Verfalls bietet uns das französische Volk. Trotz seiner günstigen
Sterblichkeit, seiner minimalen Aus- wanderung und seiner günstigen
oekonomischen Verhält- nisse ist die durch Geburtenüberschuss bewirkte
Zunahme im Laufe unseres Jahrhunderts durch das Sinken der Na- talität
(Gaburtenrate) kleiner und kleiner geworden und hat schliesslich seit
1890 einer Abnahme Platz gemacht. 5 Dumont, Arsène. Dèpopulation et
civilisation. Etude démogra- phique. Paris 1890. Und Annuaire de
l’Economie politique et de Statistique par M. Block. 1893 u. 1894.
Einzig der seit Anfang des Jahrhunderts beginnende und trotz einiger
Schwankungen regelmässige Niedergang der Geburtenziffer ist die Ursache
dieser in Frankreich so tief beklagten Erscheinung. Die entstandenen
Lücken in der Bevölkerung werden auch durch die Einwanderung Fremder
nicht mehr in dem Maasse ausgefüllt wie früher, so dass wir in dem hoch
civilisirten französischen Volk das tragische Beispiel einer sinkenden
Rasse vor uns haben, deren führende Geister den Abgrund sehen und
eifrig nach Hülfe suchen, aber für ihre Hebel den archimedischen Punkt
noch nicht gefunden haben, die gewaltige träge Masse des Volkes wieder
zu heben. Die Ursache der Verminderung der französischen Ge-
burtenziffer kann eine dreifache sein: Verminderung der Ehen,
Verminderung der durchschnittlichen physiologischen Fortpflanzungskraft
und Anwachsen der Geburten-Prae- vention. Nur die letzten beiden
Factoren können hier eine Rolle spielen. Die Eheziffer nämlich hat sich
im Lauf dieses Jahr- hunderts nicht wesentlich verändert. Sie betrug:
1801—1810 7,78 ‰ 1811—1820 7,92 „ 1821—1830 7,76 „ 1831—1840 7,94 „
1841—1850 7,93 „ 1851—1860 7,88 ‰ 1861—1870 7,9 „ 1871—1880 8,0 „
1881—1890 7,35 „ 1891—1892 7,5 „ Dumont, a. a. O. S. 73. Und Annuaire
de l’Economie polit. et de Stat. par Block. 1893 u. 1894. Die anderen
beiden Factoren finden in der durchschnitt- lichen Geburtenzahl, die
auf eine Eheschliessung kommen, ihren annähernden Ausdruck. Diese Zahl
betrug: 1800—1815 3,93 1816—1830 3,73 1831—1845 3,31 1846—1860 3,08
1861—1875 3,01 1876—1887 3,05 1888—1890 2,95 1891—1892 2,99 Ganze
Stösse von Papier sind in Frankreich und ander- wärts darüber
geschrieben worden, ob der Rückgang dieser Ziffer rein physiologisch in
einer Abnahme der Zeugungs- kraft der Geschlechter oder in einer
Zunahme der Tendenz begründet liege, die Zeugung künstlich zu
hintertreiben oder die Früchte vor der Geburt abzutödten. Darüber sind
wohl alle Autoren einig, dass praeventiver Geschlechts- verkehr und
künstlicher Abort eine grosse Rolle in Frank- reich spielen, allein
streitig ist, ob nicht noch daneben eine Abnahme der natürlichen
Zeugungskraft vorhanden ist. Manche führen als Zeichen davon die
geringe Zahl der Mehrlingsgeburten in Frankreich an. Unter 100 Ge-
borenen waren Mehrlingskinder in: 5* deutschen Staaten 2,47 Oesterreich
2,35 Ungarn 2,82 Norwegen 2,57 Belgien 1,94 Niederlande 2,56 der
Schweiz 2,32 Italien 2,40 Spanien 1,74 Schweden 2,89 Rumänien 1,75
Frankreich 1,98 Statistik des deutschen Reichs. Neue Folge. Bd. 44. S.
178. Dieses Zeichen ist jedoch desshalb nicht verwerthbar, weil die
Mehrlingsgeburten um so häufiger eintreten, je mehr Kinder schon vorher
von einer Mutter gezeugt waren, und in Frankreich ja durch das
Dreikindersystem die Ehen mit nur weniger Kindern bedeutend überwiegen.
Müller, P. Handbuch der Geburtshülfe. Stuttgart 1888 1. Bd. S. 295. In
Frankreich müssten also auch bei sonst mit anderen Ländern gleicher
phy- siologischer Fruchtbarkeit von vorn herein weniger Mehr-
lingsgeburten erwartet werden. Dumont dagegen schuldigt allein die
Praevention an: „La vraie cause de l’affaiblissement de notre natalité
est la volonté de n’avoir que peu ou point d’enfants, et cette volonté
elle-même est déterminée par un ensemble de dis- positions
intellectuelles, morales, esthétiques particulières à notre nation.
C’est le cas de répéter cette maxime d’Auguste Comte, qu’il faut
toujours avoir présente à l’esprit en traitant les problèmes de
sociologie cont emporaine: „La maladie de la société est regardée comme
physique, tandisqu’elle est exclusivement morale …“ Si chaque mariage
français n’a en moyenne que moins de trois enfants, contre quatre en
Angleterre et cinq en Prusse, c’est que le mari et la femme français ne
veulent point en avoir un plus grand nombre.“ Dumont, S. 97 u. 98
Andere Autoren, besonders der französische Anthro- pologe Lapouge,
nehmen auch eine Abnahme der na- türlichen Zeugungskraft an. Die
Gründe, welche angeführt werden, um eine Ab- nahme der Zeugungskraft
plausibel zu machen, sind zum grossen Theil wenig stichhaltig. Man
liest manchmal die Behauptung, die hohe materielle Cultur und die
fortge- schrittene Civilisation Frankreichs wären Schuld. Allein an-
dere Länder sind ebenso reich und civilisirt und nehmen doch rasch zu,
z. B. England und Deutschland, das zwar nicht ebenso reich, doch ebenso
civilisirt ist. Dazu kommt, dass Reichthum und hohe Civilisation nur
bei einer kleinen Minderheit eine Rolle spielen, die grosse Volksmasse
ist davon ausgeschlossen. Der französische Arbeiter ist immer noch
unfruchtbarer als der deutsche Kleinbürger. Lapouge sucht den Grund in
einer Abnahme der blonden Langköpfe und einer Zunahme der brünetten
Kurz- köpfe, die unfruchtbarer seien als die ersteren. Doch das- selbe
müsste dann für andere Länder mit vielen dunklen Rundköpfen der Fall
sein, wie mit Italien z. B., und doch brachte dieses von 1872 — 1883
die stattliche Fruchtbarkeit von 4,56 Geburten auf eine Eheschliessung
zu Wege. Zur Entscheidung der Frage, ob eine Schwächung der
Zeugungskraft mitwirkt, scheint mir noch am ehesten ein Blick auf das
Verhalten der durchschnittlichen Consti- tutionskraft geeignet. Wenn
sich ergiebt, dass der Durchschnittsfranzose im Lauf des Jahrhunderts
einer langsamen körperlichen Ent- artung anheimgefallen ist, so ist die
Annahme durchaus berechtigt, dass auch die Fortpflanzungskraft an
dieser Ent- artung Theil genommen hat, weil sie in gewissen Correla-
tionen zur Erhaltungskraft steht. So unmöglich erscheint die Entartung
nicht, wenn man bedenkt, wie häufig die junge Blüthe der Nation zum
Kriegsdienst herangezogen wurde. Allein vom 24. Juni 1791 bis zum 15.
Novem- ber 1813 wurden 4556000 Mann unter die Fahnen gerufen, von denen
wenigstens die Hälfte im Feuer und in den Hospitälern blieb, während
der andere Theil erschöpft und früh gealtert nach Hause
zurückkehrteDumont, a. a. O. S. 96., um mit den schwachen
Heimgebliebenen, die mittlerweile die wirth- schaftlichen Stellen
occupirt hatten, den Kampf um’s Da- sein und die Familiengründung
aufzunehmen, in dem sie oft scheiterten, so dass die Schwachen eher zur
Kinderzeugung kamen als sonst. Lagneau führt noch genauere Ziffern an:
Von 1791—99 wurden 2080000 Mann eingereiht, von denen nach
verschiedenen Schätzungen 720000 bis 1500000 fielen. Von 1799—1815
dienten 3153600 Mann. Davon blieb vor dem Feinde eine Million, eine
zweite kam in den Krankenhäusern und Lagern um. Im Krimkrieg, im
italienischen und mexikanischen Krieg, überhaupt in allen Kriegen der
Monarchien von 1825—69 wurden 356000 Leben hingerafft. Der Verlust, den
die Gesammtbevölke- rung an ihrer möglichen Zunahme durch den deutsch-
französischen Krieg und Commune-Aufstand erlitt, wird von Lagneau auf
1300000 Menschen berechnet. Die Zahl der in diesem Kriege direkt an
Wunden Gestorbenen be- trug 89000. Zu diesen Verlusten im Kriege kommen
noch die durch innere Kämpfe. Die Religionsverfolgungen früherer Zeiten
(Inquisition, Ermordung der Hugenotten) trafen zwar nicht so zahlreiche
Opfer wie die Kriege; dafür aber um so edlere. Die grosse Revolution
entzog Frank- reich ebenfalls viel tüchtiges Menschenmaterial. Viele
wanderten aus, viele wurden wirthschaftlich ruinirt, Tausende starben
auf dem Schafott. Dieses fortdauernde Riesen- würgen unter den
kräftigsten Männern der Nation legt den Gedanken an ihre Entartung in
der That sehr nahe. Die relativ niedrige Sterbeziffer, die im Lauf des
Jahr- hunderts sogar noch von 28 ‰ auf 22 ‰ gefallen ist, darf uns, wie
wir auf Seite 56 gesehen haben, nicht dazu ver- leiten, die Entartung
auszuschliessen. Wir müssen uns nach anderen Anzeichen umthun. Vor
Allem ist nötig, die Resultate der Rekrutirungen in’s Auge zu fassen.
Hören wir, was Professor Hegar darüber sagt: „Leider sind genaue
Veröffentlichungen über die Resultate der Rekrutirung nicht grade
zahlreich. Die von den Behörden gemachten Ansprüche sind ferner nicht
bloss nach den einzelnen Staaten, sondern selbst nach Zeit- räumen
grösseren oder geringeren Bedürfnisses verschieden. Auch sind die
Tauglichkeit oder Untauglichkeit bedingen- den Factoren sehr
mannigfaltig, so dass die hier in Frage stehende Wirkung (bei uns
Ursache) einer geringen oder einer bedeutenden Fortpflanzungsgrösse
sich nur schwer von den Einflüssen anderer Factoren trennen lässt .....
Auf die neueren Berichte ist vielleicht kein sehr grosser Werth zu
legen, da in Frankreich jetzt alle nur halbwegs Brauchbaren unter die
Fahne eingereiht zu werden scheinen. Die Resultate der Aushebungen von
1872—1876 sind wenigstens so gut, dass man annehmen muss, es seien sehr
geringe Anforderungen gestellt worden. Allein wir finden ähnliche
Unterschiede (von Preussen) zu Gunsten Frank- reichs auch in früheren
Jahren selbst vor dem Krimkriege 1837 und 1845 und 1851—1856“.Hegar,
Alfred, Der Geschlechtstrieb. Eine sozial-medizinische Studie.
Stuttgart 1894. S. 71. Diese Ausführungen würden also eher gegen eine
Ab- nahme der Constitutionskraft sprechen, jedenfalls nicht da- für,
charakterisiren aber die Resultate der Rekrutirung als zu unsicher, um
in der ganzen Frage nach irgend einer Richtung hin etwas zu
entscheiden. Was die Durchschnittsgrösse der Rekruten anlangt, so ist
es nach den Arbeiten von Collignon und CavetteAmmon, a. a. O. S. 120 u.
ff. wahrscheinlich, dass sie zugenommen hat. Diese Zunahme wird aber
ausdrücklich auf bessere Ernährung und dadurch beschleunigtes Wachsthum
zurückgeführt, nicht auf eine Veränderung der constitutionellen Anlage.
Ammon hat für Baden ebenfalls ein durchschnittliches Grösserwerden der
Wehrpflichtigen beobachtet, das er seit der Periode von 1840—1864, also
seit durchschnittlich etwa 38 Jahren, auf 1 bis 1,5 cm berechnet. Auch
er schreibt diese Er- scheinung ausschliesslich der beschleunigten
Entwickelung in Folge besserer Ernährung zu.Ammon, a. a. O. S. 120 u.
ff. Alle die vielen noch unsicheren Angaben über das Anwachsen der
Geisteskrankheiten, der Verbrechen und ähn- licher
Degenerations-Erscheinungen können ebenfalls nicht das starke Sinken
der Geburtenrate erklären, da dieselben oder ähnliche
Zunahmeverhältnisse auch bei anderen, sich rasch vermehrenden Völkern
Europas angetroffen werden. Man kann demgemäss zwar mit einigem Recht
ver- muthen, aber es durch nichts ganz besonders wahrscheinlich oder
gar sicher machen, dass dem Abfallen der Geburtenrate eine
Verschlechterung der durchschnittlichen Constitutions- kraft der
Franzosen zu Grunde liegt, und es wird unsern Nachbarn nichts anderes
übrig bleiben, als energisch gegen die Kinderscheu der Eheleute
anzukämpfen und vor Allem die Neigung zur Ehe zu bestärken, die in
Frankreich übri- gens nicht abnorm niedrig ist. (Eheziffer in
Frankreich 7,5—8 ‰, vergl. S. 67, im deutschen Reich 7,8—8,5 ‰, vergl.
S. 87, dagegen im Staate Massachusetts über 10 ‰). Eine Erhöhung der
Eheziffer um nur 1 ‰ würde genügen, die Bevölkerungszahl zu heben, wenn
nur die auf die Ehe entfallende Kinderzahl nicht noch weiter sinkt.
Diesen Abfall aufzuhalten, scheint mir vor der Hand unmöglich. Jeder
Arzt kennt die Gründe, wesshalb eine Mutter, die ein paar Kinder hat,
keine weiteren mehr will. Er muss diese Gründe oft genug in seiner
Sprechstunde hören: die Angst vor den Schmerzen, Gefahren, Unbe-
quemlichkeiten der Geburt, die fortwährende Hemmung der freien
Verfügung durch ein kleines Kind, die Unruhe im Haushalt, die Furcht,
durch jede neue Geburt noch mehr von der jugendlichen Elasticität
einzubüssen, hauptsächlich aber die Kosten der Erziehung und der
Wunsch, die be- reits vorhanden Kinder weder in ihrer Erziehung noch in
ihrem Erbe durch einen neuen Concurrenten zu beeinträch- tigen.Hegar,
einer der erfahrensten Frauenärzte hält eine Kinder- zahl von zwei bis
drei den Wünschen der Frauen entsprechend. Alle diese Motive wirken
zusammen, um den prae- ventiven Geschlechtsverkehr dort, wo er einmal
bekannt ist, sich so festsetzen zu lassen, wie den Gebrauch der
allernothwendigsten Güter, des Feuers, des Wassers, der vier Pfähle und
des Dachs. Das mag als eine zu gewagte Behauptung erscheinen, aber sie
ist es für mich durchaus nicht, sobald ich mir meine Eindrücke als Arzt
in’s Gedächtniss rufe. Da sehe ich nur Männer und Frauen, besonders
aber Frauen, die sich sehr energisch dagegen sträuben, mehr wie zwei
bis drei Kinder zu haben. Ausnahmen sind sehr selten. Zu- erst wird die
vom Arzt angerathene Enthaltsamkeit ver- sucht, aber bald überzeugt man
sich, dass sie undurch- führbar ist, nach kurzer Zeit wird sie
durchbrochen, und eine neue Schwangerschaft erfolgt ziemlich rasch.
Sowie aber die Praeventivmittel bekannt sind, werden in diesen
Familien, wenn schon ein paar Kinder da sind, neue Kinder nur selten,
nur aus Versehen, wie z. B. unter leichter Alkoholwirkung, erzeugt. So
sehr die Franzosen sonst Grund haben, den Alkohol zu verdammen, im
Punkt der Erhöhung der Geburtenrate mag er manches Gute gewirkt haben,
wie die noch niedrigere Kinderzahl der Ehe des nüchternen,
malthusianischen Yankees von Neuengland wahrscheinlich macht.
(Massachusetts zählte 1892 unter den Einheimischen 2,17 Geburten auf
eine Eheschliessung). An den Versuch einer Einschränkung der
Praeventiv- praxis, bezw. des Verkaufs der Praeventivmittel, durch das
Gesetz, wie es manche französische Wirrköpfe vorgeschlagen haben, ist
gar nicht zu denken. Wenn man die Erlangung der Praeventivmittel
erschwert, so bewirkt man nur, dass ausser dem armen französischen
Bauer auch der wohl- habendere Städter eine der schädlichsten Formen
des Praeventiv-Verkehrs, den Coitus interruptus, übt, der nichts kostet
und zu dem man keinerlei künstlicher Mittel bedarf. Um gegen die
Abnahme der Geburten in der Ehe wirklich etwas auszurichten, gäbe es
vielleicht eine Mög- lichkeit: die Erziehung des heranwachsenden
Geschlechts zu einer viel höheren Rücksicht auf das allgemeine Wohl,
als bei den Männern und Frauen von heute vorhanden ist, denen zwar die
Schule ein wenig gelehrt hat: Einer für Alle, denen aber Theater,
Romane und das Beispiel der wohlhabenden Klassen nur zu oft predigen:
Jeder für sich. Das einmal eine solche Aenderung der Sinnesart statt-
finden könnte, wäre ja möglich, ist aber unwahrscheinlich und würde,
wie alle Aenderungen des psychischen Inhalts bei den Massen,
allermindestens viele Jahrzehnte in An- spruch nehmen, so dass für die
nächste Zeit keines Falls darauf zu rechnen wäre. Das Dreikindersystem
muss also wohl ruhig in Kauf genommen werden. Höchstens möchten so
reichliche staatliche Entschädigungen für Kinder- pflege, wie wir sie
unten erwähnen werden, eine Aenderung zum Guten versprechen. Es bliebe
demnach den Franzosen hauptsächlich nur übrig, die Sterblichkeit noch
mehr herabzudrücken und die Ehefrequenz zu heben. Diese beiden Mittel
scheinen mehr im Bereich einer näheren Möglichkeit zu liegen: Die
Sterblichkeit der letzten Jahre betrug immer noch 20—22 ‰. Wie wir oben
sahen, betrug sie in anderen Ländern 17 ‰, ja 15—16 ‰. Es wäre also
durch energische Verbesse- rung der Lebensbedingungen und eine, wie wir
später sehen werden, vielleicht erwerbbare höhere Erhaltungskraft der
Individuen wohl möglich, die Sterblichkeit um einige Promille
herabzudrücken, was vorläufig genügen würde, die Ab- nahme der
Bevölkerung aufzuhalten. Das am meisten versprechende Mittel jedoch
scheint die Erhöhung der Eheziffer zu sein. Wie ich schon vor- her
erwähnte, hat sich diese Ziffer im Lauf des Jahrhunderts nicht
erheblich verändert, sie schwankte zwischen 7,5 und 8 ‰. Ein Promille
mehr würde genügen, die Geburtenziffer 2—3 ‰ in die Höhe zu treiben.
Frankreich wird folgenden Maasregeln auf die Dauer wohl kaum entrinnen
können, die alle darauf zielen, die Ehebedenken bei den jungen Leuten
zu zerstreuen. Leichte, kostenlose Eheschliessung, leichte
Ehescheidung, staatliche Unterstützung jeder Schwangern und Mutter
durch eine Summe, die für den bescheidenen Unterhalt während der
zweiten Hälfte der Schwangerschaft, für die Geburtskosten, die
Wochenpflege, den Unterhalt von Mutter und Kind während des ersten
Jahres und des Kindes bis zur Pubertät ausreicht. Dass diese
Forderungen an und für sich gerecht sind, liegt auf der Hand, weil sie
die Unverheiratheten und Kinderlosen zur Beihilfe an den Opfern
heranziehen, die heute allein von den Eltern im vitalsten Interesse des
Volks getragen werden. Da die Kosten der Durchführung wohl eine
Verdoppelung des jetzigen Etats bewirken würden, so würde keine
Regierung von heutzutage auch nur im Ent- ferntesten daran denken, die
Einführung der dadurch noth- wendig gewordenen Besteuerung zu
übernehmen. Halbe und Viertels-Massregeln, wie Auszahlung einer kleinen
Summe an jedes neue Ehepaar zur Gründung eines Hausstandes, würden
nicht viel nützen, und so ist wohl nur nach einem allmähligen, aber
durchgreifenden wirthschaftlichen System- wechsel in der Richtung des
Socialismus Hoffnung für die dauernde Erhöhung der Geburtenrate und die
Erhaltung der um die Menschheit so verdienten französischen Rasse
vorhanden. Eine andere sinkende Culturrasse sind die alteinge- sessenen
Yankees der Neuengland-Staaten. In Connecticut zählte man unter den
Einheimischen in den Jahren Das ergiebt jährlich, da die Auswanderung
nur gering ist, eine Abnahme des eingeborenen Elements von über 2000
Seelen. Die thatsächliche durch Geburtenüberschuss bewirkte Zunahme der
Bevölkerung des Staates um 8752 Seelen wird allein den Eingewanderten
verdankt.14., 15. und 16. Annual Report of the Connecticut State Board
of Health, New Haven 1892—94. Aehn- lich liegen die Verhältnisse in den
anderen Neuengland- Staaten. In Rhode-Island fanden unter den
Eingeborenen statt in den Jahren Dabei betrug 1891 der gesammte
Geburtenüberschuss des Staates 1874, im Jahre 1892 6200 Seelen.XL.
Registration-Report of Rhode Island. Providence 1893. In New-Hampshire
wiesen die Einheimischen für das Jahr 1891 3694 Geburten und 5637
Sterbefälle auf, d. h. einen Ueberschuss der Todesfälle von 1943.Annual
Registration-Report of New Hamsphire. Concord 1890. Im Hauptstaate
Neuenglands, Massachusetts, wurden im Jahre 1892 unter den
Einheimischen 21800 Kinder ge- boren und 35097 Todesfälle verzeichnet.
In diesem Staate, wohl dem cultivirtesten der ganzen Union, verringerte
sich also das eingeborene Element in einem Jahre um 13297 Seelen. Dabei
betrug der gesammte Geburtenüberschuss des Staats 17062, so dass das
fremde Element nicht nur diesen Ueberschuss produzirte, sondern auch
noch das De- fizit bei den Einheimischen decken musste.51.
Registration-Report of Massachusetts. Boston 1893. Diese Abnahme des
eingeborenen Elements, die aller- dings durch Auswanderung nach dem
Westen etwas geringer ist, als sie scheint, ist eine Thatsache, die
nicht nur von weiter- blickenden Yankees selbst mit Sorge betrachtet
wird, sondern die auch der weltbürgerliche Culturfreund sehr zu
beklagen hat. Nicht nur gehen dadurch die Früchte Jahrhunderte langer
Anpassung des Europäers an das amerikanische Klima wieder verloren,
sondern der erfindungsreiche und erwerbs- kräftige, aber auch
schwungvolle und generöse Charakter des Yankees würde in dem Concert
der civilisirten Völker schwer vermisst werden, wenn dieser Niedergang
andauerte. Indessen auch hier ist nach den Eindrücken von Aerzten, wie
ich auf Grund eines mehrjährigen Aufenthalts in Neu- england nur
bestätigen kann, die „Krankheit mehr eine mo- ralische als eine
physische“, so dass Hoffnung auf Heilung vorhanden ist. Eine ähnliche
Tendenz, nur in bedeutend geringerem Grade zeigt sich bei den Juden der
Vereinigten Staaten. Im 19. Bulletin des letzten Census wird über 60360
Juden in 10618 Familien berichtet, über die mit Hülfe von Rab- binern
umfangreiches statistisches Material gesammelt war. Die Schlüsse zu dem
der Censusbericht kommt, sind kurz die: Die Eherate ist gering, nämlich
nur 7,4 ‰ gegen 9—11 ‰ sonst in den nordöstlichen Staaten; die
Geburten- rate ist ebenfalls ziemlich klein: 20,8 ‰; die Sterberate ist
dafür ausserordentlich gering, nur 7,1 ‰, etwa nur halb so gross wie
bei anderen Amerikanern von ähnlicher Lebenshaltung. Dabei leben die
Juden meist in den un- gesunderen Städten. Von 18115 Männern, deren
Beruf festgestellt wurde, waren nur 84 Arbeiter und 383 Land- leute,
14527 gehörten dem Handelsstande an. Der ganz ausnahmsweis günstige
Geburten-Ueberschuss nimmt jedoch um so mehr ab, je länger der
Aufenthalt der jüdischen Geschlechter in Amerika dauert, und zwar nicht
nur durch ein Fallen der Geburtenrate, (5,39 Kinder auf eine einge-
wanderte, 3,56 auf eine eingeborene jüdische Mutter), son- dern auch
durch ein Ansteigen der Sterberate. Die jüdische Rasse in Amerika weist
also in Bezug auf Bevölkerungs- bewegung eine ähnliche Tendenz auf als
die Yankees, nur ist sie bei ihr noch im Anfang, so dass bis jetzt die
Zu- nahmerate nur vermindert, nicht aufgehoben ist. Aufsteigende
Rassen. Ich habe den Fall Frankreichs etwas ausführlicher be- sprochen,
weil er einzig da steht unter den Völkern arischer Rasse in Europa.
Alle anderen sind in rascherem oder langsamerem Anwachsen begriffen.
Irland, das eine Aus- nahme zu machen scheint, schuldet seinen Rückgang
der starken Auswanderung, nicht etwa Fehlbeträgen der Ge- burtenrate.
Europa mit seinen Tochterländern Amerika und Australien, die zusammen
die Hauptmasse der europäischen Arier und ihrer Abkömmlinge, kurz West-
arier, enthalten, zeigen eine starke Bevölkerungszunahme, die
angesichts der Thatsache, dass die Arier unter den grossen Rassen
vorzüglich den Namen einer Culturrasse verdienen, hoch erfreulich ist.
West-Arier. Wenn wir in Folgendem versuchen, in rohen Umrissen die
Zunahme-Verhältnisse der West-Arier festzustellen, so müssen wir uns
bewusst bleiben, dass wir dazu nur zwei Merkmale haben: die
Angehörigkeit zur weissen Rasse und die zu einer der west-arischen
Sprachen. Das erste Mo- ment schliesst z. B. die englisch und spanisch
sprechenden Neger und Indianer Amerikas aus, das zweite giebt wenig-
stens eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass mit dem Sprach- gebiet die
Verbreitung der Rasse proportional ist. Das ist jedoch nur ein
Nothbehelf, wir können nicht genau weder die stattgehabten
Vermischungen mit anderen Rassen con- troliren, noch die Verschiebungen
durch die in diesen Mischungen ungleichartig auf die einzelnen
Bestandtheile einwirkende natürliche Auslese bestimmen, noch auch
wissen, wie weit sich die Sprache der Westarier auf andere unterworfene
Rassen einfach ausgedehnt hat, oder West- arier andere Sprachen
angenommen haben. Trotzdem dürfte die Zahl der eine west-arische
Sprache als Mutter- sprache redenden Weissen ein ungefähres Bild der
Ver- breitung der west-arischen Rasse selbst abgeben. Bei den
Ostariern, den Hindus, Iranern etc. sind die Verhältnisse in dieser
Beziehung noch unsicherer, so dass ich auf ihre Hineinziehung
verzichten will. Europa, das nach Mulhall vor dem 15. Jahrhundert nie
die Zahl von 50 Millionen erreichte, zählte 1866 etwa 283,9 Millionen,
1880 schon 327 1890 362 Millionen Ein- wohner trotz seiner grossen
Auswanderung. Von dieser ganzen Ziffer waren 1860/61, nach Böckh nur
6,8 % nicht Westarier, 1890 7,2 %. Daraus folgen als absolute Zahlen
für die Arier in Europa für 1860/61 etwa 268,6 Millionen, im Jahre 1890
etwa 336,5 Millionen. In Amerika wohnen jetzt etwa 60 % Arier, und zwar
so gut wie ausschliesslich Germanen und Romanen, und 40 % Nicht-Arier:
Indianer, Neger und Mischlinge, von denen die Idianer absolut abnehmen,
und die Neger und Misch- linge sich nicht so sark vermehren als die
Weissen, so dass der Haupttheil der Bevölkerungszunahme Amerikas auf
die Arier zu setzen ist. Amerika hatte um 1860 etwa 71,5 Millionen Ein-
wohner, um 1890 dagegen 123 Millionen, von denen 75 Millionen als Arier
7 „ „ Indianer 9 Millionen als Neger 32 „ „ Mischlinge der drei Rassen
angesehen werden. Nehmen wir den Procentsatz der Arier, der jetzt ca.
60 ist, und für 1870 auf ca. 52 geschätzt werden kann, für das Jahr
1860 zu 50 an, was angesichts der geringeren Vermehrung der Nichtarier
wohl noch zu hoch gegriffen ist, so erhalten wir immer noch während der
30 Jahre eine Zunahme der Arier von etwa 36 Millionen auf 75 Millionen.
In Australien mit Neuseeland spielen die beständig ab- nehmenden
Urrassen fast keine Rolle mehr; ihr Aussterben ist nur eine Frage der
Zeit. Gegenwärtig beträgt ihre Zahl noch etwa 240000, die nicht in den
folgenden Ziffern enthalten sind. Australien mit Neuseeland hatte 1860
etwa 1,3 Milli- onen Einwohner, so gut wie ausschliesslich germanischer
Zunge, 1890 etwa 3,8 Millionen, von denen 41000 Chinesen waren. Die
Gesammtbevölkerung von Weissen, die wir wenig- stens der Sprache nach
als Westarier ansehen müssen, stieg also von: ca. 306 Millionen um’s
Jahr 1860 auf ca. 413 „ „ „ 1890, wuchs also um mehr wie ein Drittel,
nämlich 35 %, während die Bevöl- kerung der ganzen Erde sich in
derselben Zeit von min- destens ca. 1250Geschätzt nach Behm’s geogr.
Jahrbuch, 1. Bd., wo die Erd- bevölkerung für Mitte der 60er Jahre auf
ungefähr 1350 Millionen beziffert wird und nach Kolb, der für 1868 1270
Millionen angiebt. auf 1472Nach Wagner und Supan 1480 Millionen für das
Jahr 1890 bei einer Zunahme gegen 1880 von 79 Millionen. Millionen
vermehrte, also nur um etwa 18,5 %, d. h. sie wuchs etwa nur halb so
langsam. Daraus erhellt der Sieg der westarischen Rassen im Kampf um’s
Dasein mit der Gesammtheit der anderen Rassen. Die Zahl der Arier
überhaupt wird gegenwärtig auf 633 Millionen oder etwa 44 % der
Erdbevölkerung geschätzt. Germanen. Unter den arischen Rassen haben die
Germanen für uns das nächste Interesse, da unser deutsches Volk zu
ihnen gehört. Wir wollen desshalb kurz Bevölkerungs- ziffer und
Zunahmerate ihrer Hauptwohngebiete anführen. Die Germanen zerfallen
heute in drei grosse sprach- liche Unterabtheilungen: die Skandinavier
in Schweden, Finnland, Norwegen, Island, Dänemark und Nord-Schleswig,
zweitens die Deutschen in Deutschland, den Niederlanden und Theilen
Belgiens, der Schweiz, Oesterreich-Ungarns und Russlands, drittens die
Angelsachsen in Grossbritannien, Irland, Britisch Nordamerika,
Vereinigte Staaten von Amerika und Australien mit Neuseeland. Die
gesammte germanische Sprachwelt, deren Verbrei- tung unter den Weissen
wohl ungefähr mit der der ger- manischen Rasse proportional ist, zählte
im Jahre 1860/61 in Europa etwa 86,9 MillionenNach R. Böckh, Der
Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet. Berlin 1869., um 1860 in
Nordamerika etwa 27,8 Millionen, davon ca. 25700000 in den Verein.
StaatenCompendium of the 11 th. Census. Part I. Population. S. XXXV,
XCVIII und Census Bulletin vom 16. Februar 1893. Washington. D. C.
Seite 2. Aus diesen beiden Quellen abgeschätzt. und ca. 2100000 in
Britisch Nordamerika, sowie im Jahr 1860 in Australien und Neuseeland
etwa 1300000 Germanen. Das ergiebt zusammen um das Jahr 1860 herum eine
germanische Volkszahl von ungefähr 116 Millionen, d. h. 38 % der
Westarier und etwa 9,2 % der Erdbevölkerung. Um das Jahr 1890 herum
betrug die Zahl der Ger- manen in Europa 111937000, in Nordamerika 52,7
Milli- onen, davon 3400000 in Britisch Nordamerika und etwa 6 49300000
in den Vereinigten Staaten. Letztere Ziffer ist dadurch gewonnen, dass
von den 54984000 Weissen, die 1890 im Gebiet der Vereinigt. Staaten
gezählt wurden, etwa 5700000 als Nicht-Germanen abgezogen
wurden.Abgeschätzt nach dem Extra-Census-Bulletin vom 1. No- vember
1894. Washington. D. C. S. 12. Australien mit seiner beinahe rein
germanischen Be- völkerung zählte 1890 3,8 Millionen. Diese drei Posten
zusammen ergeben die Summe von 168,4 Millionen als Gesammtheit der
Germanen im Jahre 1890 in den herangezogenen Hauptwohngebieten. Das
ergiebt gegen 1860 eine Zunahme von etwas mehr als 45 %. Von den
Westariern machten die Germanen im Jahre 1890 40,8 % aus, gegen 38 % im
Jahre 1860, und von der Gesammt-Erdbevölkerung 12,8 %, gegen 9,2 % im
Jahre 1860. Aus der Thatsache, dass die Westarier sich von 1860—90 um
35 %, ihr germanischer Zweig dagegen in in derselben Zeit um 45 %
vermehrte, erhellt, dass die Germanen bedeutend rascher anwachsen, als
der Rest der Westarier, und sich dadurch als im Kampf um’s Dasein
höchst tüchtige Zweige derselben kundgeben. Uns als Deutsche
interessirt noch, wie sich unter den Germanen wieder die einzelnen
Stämme seit 1860 ver- schoben haben. 1860/61 wurden geschätzt: in
Europa 52140000 Deutsche und Niederländer, 27260000 Engländer, 7530000
Skandivavier,Nach R. Böckh, a. a. O. S. 307. 1860 in Nord Amerika
4000000 Deutsche und Niederländer, 23500000 Engländer, 250000
Skandinavier, 1860 in Australien 50000 Deutsche, 1250000 Engländer,
zusammen etwa 116 Millionen Germanen, davon etwa 56 Millionen Deutsche,
d. i. 48,4 %, „ 52 Millionen Engländer, d. i. 44,8 %, und „ 7,8
Millionen Skandinavier, d. i. 6,7 %. Engländer und Deutsche hielten
sich also im Grossen und Ganzen die Wage. Dreissig Jahre später, 1890,
schätzte man in Europa 66734000 Deutsche (stets einschl. Niederl.),
35703000 Engländer, 9500000 Skandinavier, in Nordamerika 8000000
Deutsche, 42900000 Engländer, 1800000 Skandinavier, in Australien
200000 Deutsche, 3500000 Engländer, 100000 Skandinavier, zusammen etwa
168400000, davon ca. 75 Millionen Deutsche, also 44,5 %, „ 82 „
Engländer, also 48,7 %, und „ 11,4 „ Skandinavier, also 6,8 %. Daraus
geht hervor, dass die germanischen Stämme sich zwar nur wenig in Bezug
auf die Rate ihrer Zunahme unterscheiden, aber es scheint doch, dass
die Angelsachsen rascher fortschreiten, als die übrigen Germanen.
Völlig sicher sind diese Angaben natürlich nicht; für Europa ist ein
genügender Grad von Genauigkeit vorhanden, aber in Nordamerika kann die
Abtrennung der Angelsachsen von den anderen Germanen nur eine sehr rohe
sein, da letztere sich sprachlich rasch aufsaugen lassen, ohne dabei in
der Kindererzeugung den Angelsachsen irgendwie nach- zustehen. Dieses
Aufsaugen der deutschen Sprache in Amerika geht so rasch vor sich, dass
ihr allmähliches Ver- schwinden nur eine Frage der Zeit ist. Für Europa
allein dagegen haben wir ziemlich zuver- lässige Daten, natürlich auch
nur nach den Sprachen ab- 6* geschätzt. Nach Böckh’sa. a. O. S. 307.
gründlichen Berechnungen zählte Europa 1860/61 in Millionen: 52,14
Deutsche = 18,37 % 27,26 Angelsachsen = 9,60 „ 7,53 Skandinavier = 2,65
„ zusammen 86,93 Germanen = 30,62 % 92,86 Graeko-Romanen = 32,7 % 78,71
Slaven = 27,7 „ 3,00 Kelten = 1,1 „ 3,00 Letten und Littauer = 1,1 „
4,06 Juden = 1,4 „ 15,30 andere, nicht westar. Stämme = 5,4 „ 283,86
100,0 % um 1890 in Millionen: 66,734 Deutsche = 18,42 % 35,703
Angelsachsen = 9,86 „ 9,5 Skandinavier = 2,62 „ zusammen 111,937
Germanen = 30,80 „ 106,732 Graekoromanen = 29,5 „ 111,312 Slaven = 30,7
„ 3,380 Kelten = 0,9 „ 3,150 Letten u. Littauer = 0,9 „ 5,970 Juden =
1,6 „ 19,793 andere, nicht west- arische Stämme = 5,6 „ 362,274 100,0 „
Der hevorstechendste Unterschied in den beiden Zahlen- reihen besteht
in der Abnahme der Gräkoromanen um fast 10 % ihres früheren Antheils
und der Zunahme der Slaven um ebenso viel. Der Antheil der Germanen hat
nur sehr wenig, um 0,6 % zugenommen. Dagegen hat sich der Antheil der
Juden um mehr als 14 %, der der nichtwestarischen Stämme um beinahe 4 %
vermehrt. Die Juden haben also von allen Rassen in Europa den stärksten
Aufschwung genommen. Was die Verschiebungen innerhalb der europäischen
Germanen selbst anlangt, so waren von ihnen d. h. die Engländer
scheinen auf Kosten der Deutschen und noch mehr der Skandinavier
zuzunehmen. Um kurz das allgemeine Weltbild der Rassenver- schiebung,
wenigstens soweit die West-Arier in Betracht kommen, zu recapituliren:
Auf der ganzen Erde eilen die Westarier der Gesammtheit der anderen
Rassen voran, die Germanen der Gesammtheit der nicht-germanischen West-
arier, und die Engländer den anderen Germanen. — In Europa dagegen
haben die Westarier gegen die anderen Stämme eine leichte Einbusse. Die
Slaven, nächst ihnen in bedeutend geringerem Grade auch die Germanen,
über- flügeln die anderen Westarier, und unter den Germanen scheinen
die Engländer am raschesten anzuwachsen. Instructiv für das relative
Umsichgreifen der Sprache und dadurch des Geistes der einzelnen
westarischen Rassen überhaupt ist eine Zusammenstellung von MulhallThe
World Almanac a. Encyclopedia. New York, 1894. S. 59.: Die grösseren
europäischen Sprachen wurden in der Welt gesprochen im Jahre 1801 von
161,8, im Jahr 1890 von 401,7 Millionen. Davon entfielen in Procenten
auf: Die englische Sprache wird Weltsprache, wenigstens in der
civilisirten Welt. Ein Wink für unsere wohlmei- nenden
Volapük-Schwärmer und für unsere zopfigen La- teiner und Griechen.
Staaten mit deutscher Bevölkerung. Das deutsche Reich, das den
Haupttheil der deutschen Rasse in seinen Grenzen beherbergt, zeigt seit
Jahrhunderten eine regelmässige Zunahme seiner Bevölkerung trotz vieler
Kriege und trotz starker Auswanderung. Auf dem heutigen Reichsgebiet
wohnte eine Bevölkerung von 24833000 im Dez. 1816 26294000 „ „ 1820
32787000 „ „ 1740 37747000 im Dez. 1860 45236000 „ „ 1880 49428000 „ „
1890, die mittlere Bevölkerung von 1894 war 51217000. Die Bevölkerung
hat sich also seit den letzten 75 Jahren unge- fähr verdoppelt. Die
Geburtenrate ist relativ hoch und die Sterbeziffer mittelgross. Auf
1000 der mittleren Be- völkerung kommen jährlich Wir haben hier das
Bild eines kräftig wachsenden Volkes vor uns, das sich in seinen
elementaren Lebensvorgängen höchst augenfällig von dem französischen
unterscheidet. Hand in Hand mit der sich ziemlich gleich bleibenden
Geburtenrate gehen wenig schwankende Ziffern für Ehe- frequenz und
eheliche Fruchtbarkeit: Die jährliche Zunahme der Bevölkerung beträgt
denn auch trotz der grossen Auswanderung (1889—93 über 500000) von
1841—45 9,6 ‰ „ 1846—50 5,7 „ „ 1851—55 4,0 „ „ 1856—60 8,8 „ „ 1861—65
9,9 „ „ 1866—70 5,8 „ von 1871—75 9,1 ‰ „ 1876—80 11,4 „ „ 1881—85 7,0
„ „ 1886—90 10,7 „ „ 1891—94 10,0 „ Aus und uach dem Statist. Jahrbuch
für das Deutsche Reich, Berlin 1894. S. 2 u. 12. Die Vertheilung der
Sprachen gestaltete sich folgen- gendermassen: Im Jahre der Gründung
des Reichs waren 90,75 % seiner Bevölkerung Deutsche, im Jahr 1890 91,8
%. Die Deutschen haben also relativ etwas zugenommen, und zwar auf
Kosten sämmtlicher anderen Volkselemente mit Ausnahme der Skandinavier.
Von der Gesammtbevölke- rung waren: Was speziell die vielbesprochene
Verschiebung des polnischen Elementes in Preussen anlangt, so mögen
folgende Ziffern, die der Zeitschrift des kgl. preuss. statist. Bureaus
(33. Jahrgang, S. 194 u. 195) entnommen sind, einen An- halt gewähren:
Die Polen, einschliesslich Masuren und Kassuben, machten 1867 10,7 %
der Bevölkerung Preussens aus, 1890 nur noch 9,94 %, es ist demnach in
den 23 Jahren eine kleine Abnahme zu verzeichnen. Diese Abnahme ist je-
doch keine gleichmässige, sondern es giebt einige Districte, wo die
Polen stärker zugenommen haben als die Deutschen, das sind die
Regierungsbezirke Cöslin, Bromberg, vor allem aber Posen. Von den
sonstigen slavischen Stämmen Preus- sens, die nur unbedeutende
Bruchtheile der Bevölkerung bilden, haben die Wenden beträchtlich
abgenommen, da- gegen die Tschechen, die hauptsächlich in Oberschlesien
wohnen, sich deutlich vermehrt. Die Gesammtheit der Slaven hat
abgenommen. Die Juden, deren Zahl in Europa so stark angewachsen ist,
sind im Deutschen Reich hinter der übrigen Bevölkerung zurückgeblieben.
Hier kamen auf je 1000 Einwohner im Jahre 1871 12,5, 1880 12,4 und 1890
11,5 Juden. Die Schweiz hatte 1860/61 2510500 Einwohner, davon waren
etwa 1761000 oder 70,3 % Deutsche. Im Jahre 1888 stieg die
Einwohnerzahl auf 2933000, die Zahl der Deutschen auf 2092000 oder auf
71,3 % der Bevölkerung. Die Deutschen haben also in den letzten
Jahrzehnten je- denfalls ihren Stand behauptet. Auf dem heutigen Gebiet
Oesterreich-Ungarns ohne Bos- nien zählte man nach Böckh 1860/61
8400000 Deutsche (ohne Juden) unter einer Gesammt-Bevölkerung von
33978400, im Jahre 1890 9583000 Deutsche unter 39850000 Ein- wohnern.
Der Procentsatz der Deutschen betrug 1860/61 24,72, im Jahre 1890
dagegen nur 23,15. Die Sprachen- zählungen sind in Oesterreich-Ungarn
nicht zuverlässig genug, um aus dieser Abnahme des Procentsatzes einen
Nieder- gang des Deutschthums mit Sicherheit zu erschliessen, allein er
wird doch sehr wahrscheinlich gemacht. Was nützen dagegen die vielen
Lieder und Reden, in denen unsere österreichischen Volksgenossen von
deutscher Kraft singen und sagen, was nützen die Turn- und Schützenver-
eine, die Festbankette und der Streit um Strassenschilder? Im Schooss
der Familie entscheiden sich die Kämpfe der Rassen. Im europäischen
Russland (mit Polen und Finnland) schätzte Böckh die Zahl der Deutschen
für 1860/61 auf 854000 oder 1,27 % der Bevölkerung. Im Jahre 1891
zählten die Deutschen 1360000 oder 1,39 % der Bevöl- kerung. In den
Niederlanden mit Luxemburg betrug der Pro- centsatz der Deutschen,
einschliesslich Niederländer, 1860/61 97,87 %, 1889/90 97,12 %. In
Belgien machten Deutsche, einschliesslich Vlamen, 1860/61 55,75 %, im
Jahre 1890 55,35 % der Bevölkerung aus. Diese Unterschiede fallen
vollkommen in die Fehlergrenzen, so dass von einer nennenswerthen
Verschiebung in diesen beiden Staaten keine Rede sein kann. Das
Vordrängen der Deutschen gegen andere Volks- elemente scheint sich also
auf das Deutsche Reich und die Schweiz zu beschränken. Wir haben bei
den obigen Angaben nur Westarier und Juden als Culturrassen
berücksichtigt. Damit soll nicht ge- sagt sein, dass es nicht
vielleicht noch andere Rassen giebt, die in ähnlicher Weise culturfähig
sind. Man wird sofort an die Magyaren denken, vielleicht auch an die
Ja- paner. Allein die Betrachtung der Japaner, die ihre hohe Stellung
in Asien höchst wahrscheinlich einer glücklichen Mischung von Mongolen
und Malaien ver- danken, würde uns zu weit abführen. Was die Magyaren
betrifft, das einzige grössere, nicht-arische Sprachelement Europas, so
bilden sie vom Rassenstandpunkt aus eine so mannigfaltige Mischung,
besonders auch in Folge der rück- sichtslosen Magyarisirung der
ungarischen Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten, dass es sehr
zweifelhaft ist, ob finnische oder arische Elemente bei ihnen
überwiegen. 3. Capitel. Die Vervollkommnung des Typus. Wesen der
Vervollkommnung die Verstärkung und höhere Differenzirung der
Regulationskraft. Gorilla, Neger, Weisser. Ge- hirnentwickelung. —
Vollkommnere und stärkere Convariante. Rück- schritt der Organisation.
Panmixie. Panmixie beim Menschen? Schönheit, Altruismus, hohes Alter. —
Rassenhygienische Forderungen für Vervollkommnung des Typus und
Vermehrung der Zahl. — Hat sich der menschliche Typ in den letzten
Jahrtausenden vervoll- kommnet? Schreitet er gegenwärtig noch fort? —
Die besten Rassen. Westarier, Juden. Wesen der Vervollkommnung. Vgl.
ausser bereits früher angeführten Werken Darwin, Ch., Die Abstammung
des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl. Deutsch von Carus. III.
Aufl. Stuttgart 1875. — Haeckel, E. Anthropogenie. III. Aufl. Leipzig
1877. Worin besteht das Wesen der Vervollkommnung? Warum ist der Weisse
vollkommener als der Neger und dieser vollkommener als der Gorilla?
Doch offenbar, weil sich die kaukasische Rasse besser und öfter den
verschie- denen Bedingungen der Erde anpassen kann als die Neger- rasse
und diese wieder mehr als der Gorilla. Angenommen auf der Erde wären
keine Menschen und keine Menschen- affen vorhanden, sondern nur die
Gorillas. Dann würde diese Art sich allmählich auf einen bestimmten
Theil der Erde ausbreiten und eine bestimmte Anzahl Individuen liefern
können. Da die Gorillas nur in den Wäldern der heissen Zone leben
können, Viehzucht und Acker- bau nicht treiben, und da sie bei ihrer
geringen Intelligenz unfähig wären, das Meer zu kreuzen, um Amerika und
Australien zu besetzen, so würden sie nur in verhältnis- mässig sehr
geringer Zahl auf der Erde vorhanden sein. Die Neger könnten, wenn
keine anderen menschlichen Rassen existirten, sich schon in viel
grösserer Zahl auf der Erde ausbreiten. Sie verfertigen Werkzeuge,
treiben Vieh- zucht, Ackerbau und Fischfang, befahren das Wasser und
haben desshalb nicht nur die Potenz, ihrer jetzigen Heimath eine viel
grössere Individuenzahl abzuzwingen, sondern können leicht in andere
Länder auswandern, allerdings nur in die tropische und in die warmen
gemässigten Zonen. In anderen Klimaten würden sie von Lungenleiden
hinge- rafft werden. In Afrika ist thatsächlich vom Gorilla nur ein
kleiner Theil der tropischen Wälder in sehr dünner Weise bevölkert,
während der Neger einen grossen Theil Afrikas bewohnt und leicht einen
qkm mit 10 Einwohnern bevölkern kann (die Bevölkerungsdichtigkeit des
Kongo- staats). Der Kaukasier vollends würde, wenn alle anderen Rassen
fehlten, mit Ausnahme der ungünstigen Theile der Tropen die ganze Erde
ausfüllen und mit Hülfe seiner In- telligenz und der von ihr
geschaffenen mächtigen Werkzeuge soviel aus dem Boden herausziehen,
dass er bequem den qkm mit 50 bis 100 Individuen besetzen könnte.
Eigent- lich sollten wir noch das Gewicht des Gorillas, des Negers und
des Kaukasiers mit in die Berechnung ziehen, um zu sehen, wieviel
lebendige Substanz in jeder dieser drei Formen sich auf der Erde würde
halten können; dass ist aber bei der Aehnlichkeit der Körpergewichte
(nur der Gorilla ist nennenswerth schwerer) und bei den so stark
ausgeprägten Unterschieden in der Zahl der Individuen be- langlos.
Dort, wo die Weissen nicht durch die Extralwirkungen der Tropen und die
Neger nicht durch die der kälteren Zone zu stark hingerafft werden, und
wo beide Rassen zu- sammenleben, wie in den Südstaaten der
amerikanischen Union, tritt der Fortschritt der Weissen gegenüber dem
Neger klar zu Tage. In den Jahren von 1880—1890 vermehrten sich beide
Rassen in den südatlantischen und südcentralen Staaten, die die grosse
Masse der Neger der Union beherbergen, in folgender Weise: Compendium
of the 11. Census. Part I. Washington, 1892. S. CVII. Der Census vom
Jahre 1870 war in diesen Staaten unzuverlässig, und vor dem
Bürgerkriege war die Einwan- derung der Neger zu gross, um frühere
Zählungen als 1880 zum Vergleich heranziehen zu dürfen. Um nicht
missverstanden zu werden, wollen wir hin- zufügen, dass solche Ziffern
natürlich keinen strengen Be- weis für die höhere Beanlagung des
Weissen involviren, allein sie machen sie doch ausserordentlich
wahrscheinlich, besonders wenn man sie mit den weiter unten erwähnten
Resultaten der Schulerziehung der Neger zusammenhält. Die starke
Superiorität des Weissen über den Neger und des Negers über den Gorilla
muss schliesslich darauf beruhen, dass die Regulationsfähigkeit gegen
die Umgebung im ersten Falle beim Weissen, im zweiten beim Neger eine
grössere ist, d. h. dass die Summe oder die Stärke der
Regulationsmechanismen eine grössere ist, oder mit anderen Worten, dass
das Spiel von Action nnd Reaction zwischen den äusseren Wirkungen und
dem Organismus ein vielsei- tigeres und feineres ist. Das bedeutet aber
für die sicht- bare oder unsichtbare Structur des Körpers eine grössere
Complication. Das Wesen der Vervollkommnung scheint also in der
vielseitigeren und feineren Functionirung und der damit verbundenen
differenzirteren Structur zu liegen. Jedenfalls ist diese höhere
Differenzirung weitaus das Haupt- moment dabei, wie von allen Biologen
angenommen wird. Sehen wir uns nun die Fähigkeiten des Gorilla, des
Negers und des Weissen darauf hin näher an, so bemerken wir kaum einen
Unterschied in der rohen Erhaltungskraft gegen die einfachsten
Natureinflüsse wie Witterung, Nah- rungsmangel etc., im Gegentheil,
darin, wie in der groben Muskelkraft, ist vielleicht der Gorilla dem
Neger überlegen. Dagegen fällt sofort auf, dass der Gorilla ausser
gelegent- lich einem Stock keine Werkzeuge gebraucht, und dass er
vielen Gefahren gegenüber, wo nur Schlauheit nützen würde, sich nicht
erhalten kann, mit einem Wort, er ist nicht so intelligent wie der
Neger. Ebenso steht es mit dem Unterschiede zwischen Neger und Weissen.
Der Unterschied in Intelligenz und socialen Instincten ist auch hier
ziemlich gross, wenn auch nicht so gross, wie zwischen Neger und
Gorilla. Die mangelhaftere Ausbildungsfähig- keit der Negerkinder,
selbst wenn die Erziehung mit der der Weissen gleich ist, ist eine
Thatsache, die jedem amerikanischen Volksschullehrer geläufig ist.
Selbst, wenn einzelne Neger bis zum Besuch von Colleges vordrangen, ist
aus ihnen noch niemals eine hervorragende Intelligenz erstanden, und
keine der grossen Geistes-Errungenschaften der Menschheit verdanken wir
einem Neger.In den südatlantischen und südcentralen, den Neger-Staaten,
wurden 1890 unter den eingeborenen Weissen 14—15 % Analpha- beten
gezählt, unter den Negern 60—61 %, in den nordatlantischen und
nordcentralen Staaten unter den eingeborenen Weissen 2,3—3,4 % unter
den Negern 21—32 %, für die ganze Union sind die beiden Zahlen 6,2 %
und 56,8 %. Ich glaube nicht, dass diese beträchtlichen Unterschiede
ganz auf die frühere Sklaverei zurückgeführt werden können. Diese
geistigen Unterschiede werden gut illustrirt durch die
Entwickelungs-Unterschiede des Gehirns, also des Or- gans, an dessen
chemisch-physikalische Functionen die geistigen Vorgänge als Parallelen
geknüpft sind. Nach Hux- ley ist das höchste Gewicht des Gorillagehirns
trotz der grossen Schwere des Gorillaleibes (über 100 kl) nicht mehr
wie 570 g Wallace, a. a. O. S. 708., während das mittlere Hirngewicht
beim männ- lichen Europäer 1360 g, beim männlichen Neger 1244 g
beträgt.Kurella, H. Naturgeschichte des Verbrechers. Stuttgart 1893.
Nach Herbert Spencer ist das Gehirn des civilisirten Menschen um 30 %
schwerer als das des Wilden. Nach Broca verhält sich die
Schädelcapacität des Euro- päers zu der des Negers wie 124,8:111,8.
Professor Flo- wer giebt für den Schädelinhalt bei Afrikanern 1390 und
für den bei Europäern 1490 ccm an, Barnard Davis nach zahlreichen
Messungen 1412,6 bezw. 1509,2 ccm. Auch in Bezug auf den
Windungsreichthum des Gross- hirns steht der Gorilla am tiefsten, der
Weisse am höchsten. Dasselbe gilt vom Massenverhältniss des Grosshirns
zu dem Rest des Centralnervensystems. Der Westarier hat das relativ
schwerste, der Gorilla das relativ leichteste Gross- hirn. Doch wir
wollen uns nicht in diese Organisations-Un- terschiede des Gehirns
vertiefen, sondern nur daran erinnern, dass die grössere
Vervollkommnung auf den letzen Stufen der organischen Entwickelung, bei
den Spitzen der Säuge- thiere, fast ausschliesslich Hand in Hand mit
einer Ent- wickelung der Grösse und Complication des Gehirns ging.
WallaceWallace, a. a. O. S. 601. citirt darüber Marsh: „Das wirkliche
Vor- handensein eines Fortschrittes in der Säugethierwelt Ame- rikas
vom Beginne der Tertiärzeit an bis jetzt wird sehr schön durch die
Zunahme des Gehirns nachgewiesen, in der wir den Schlüssel zu vielen
andern Umwandlungen haben. Die ältesten tertiären Säugethiere, welche
wir kennen, hatten sämmtlich ein sehr kleines Gehirn. … Es fand dann
ein allmähliches Wachsthum des Gehirns während jener Periode statt, und
es ist wichtig, dass dieses Wachsthum sich haupt- sächlich auf die
Hemisphären des grossen Hirns, auf die höhere Abtheilung des Gehirns,
beschränkte. Bei den meisten Ordnungen und Familien der Säugethiere ist
das Hirn all- mählich mit stärkeren und zahlreicheren Windungen ausge-
stattet und damit an Qualität so gut wie an Quantität vorgeschritten …
Während des langen Kampfes um’s Dasein während der Tertiärzeit siegten
— damals wie auch jetzt noch — die grösseren Gehirne. Die so ge-
wonnene grössere Kraft machte nun manche Vor, richtungen überflüssig,
welche von Urahnen ererbt- aber den neuen Verhältnissen nicht mehr
angepasst waren.“ Weiterhin sagt Wallace selbst: Wallace, a. a. O. S.
707 „Es ergiebt sich hieraus, dass seit der Zeit, wo die Urmenschen
zuerst aufrecht gingen, die Hände frei und nicht beim Fortbewegen
nöthig hatten, wo ihre Gehirnthätigkeit sie befähigte, die Hände zur
An- fertigung von Waffen und Werkzeugen, von Wohnungen und
Kleidungsstücken zu verwenden, Feuer zum Kochen der Speisen zu erzeugen
und Samen oder Wurzeln zu säen oder zu pflanzen, um die nöthige Nahrung
zu erzielen, dass seit dieser Zeit die natürliche Zuchtwahl aufgehört
haben muss, Modificationen ihres Körperbaues zu veranlassen, sondern
vielmehr ihren Geist mit Hülfe des Organs des- selben, des Hirnes,
weiter entwickelte. Auf diesem Wege mag der Mensch, der wahre Mensch,
die Art Homo sapiens geworden sein — sogar schon in der Miocänzeit. Und
während alle übrigen Säugethiere von einer Epoche zur anderen unter dem
Einfluss der beständig wechselnden phy- sischen und durch andere
Lebewesen bedingten äusseren Verhältnisse umgemodelt wurden, nahm er
hauptsächlich an Denkvermögen zu, machte vielleicht aber auch Fort-
schritte im Bau oder an Grösse; durch die Zunahme der Intelligenz
allein war er im Stande, sich als Herr über alle Thiere und als der am
weitesten verbreitete Bewohner der Erde zu behaupten.“ Wir erkennen
hieraus, mit welcher enormen Kraft und Feinheit die
Regulations-Mechanismen des Gehirns arbeiten, und dass sie ganz gut
einige andere Regulationen über- flüssig machen konnten. So sind z. B.
die Vorrich- tungen in unserem Körper, um langes Hungern und Dursten zu
ertragen, entschieden schwächer als die der Wilden, da eben unser
Gehirn besser für regelmässige Stillung sorgen kann. Unsere Zähne sind
kleiner geworden, weil unser Gehirn die Speisen besser zu präpariren
lehrt. Aus demselben Grunde, dem der besseren Regulirung durch das
Gehirn, scheinen noch verschiedene Regulationen an- derer Organe gegen
eine ganze Reihe von Extraleinflüssen von ihrer früheren Höhe
herabgegangen zu sein. Diese stellenweise Vereinfachung ändert aber
nichts daran, dass der Gesammtorganismus einer besseren Regulation
fähig geworden ist, mit anderen Worten, dass die Gesammt-Er-
haltungskraft durch die Ausbildung des Gehirns eine grössere geworden
ist. Eine ähnliche Rolle, wie für die Erhaltung des Individuums,
spielte das bessere Gehirn auch für die Fortpflanzungsfunctionen. Durch
verfeinerte Beobachtung wurde die sexuelle Auslese bei der Gattenwahl
eine schärfere, während der Schwangerschaft, der Säugungs- und der
ganzen späteren Erziehungs-Periode war der hö- heren Intelligenz
vollauf Gelegenheit gegeben, das ganze Fortpflanzungsgeschäft günstig
zu beeinflussen, war also ihrem Träger eine wesentliche Verstärkung
seiner Fort- pflanzungskraft. 7 Vollkommenere und stärkere Variante.
Panmixie. Nach den obigen Ausführungen bedeutete ein besseres Gehirn
für seinen Besitzer eine Verstärkung der gesammten Constitutionskraft.
Zwischen einer vollkommneren Convari- ante und einer stärkeren war also
in Bezug auf diesen Punkt kein Unterschied. Ebenso ist klar, dass auch
alle anderen besseren Regulations-Vorrichtungen, wo sie uns offenbar
werden, von uns Vervollkommnungen genannt werden müssen. Jede Erhöhung
unserer Kraft, die Aussen- welt zu beherrschen und uns Geltung
gegenüber unseren Artgenossen zu verschaffen, bezieht sich eben direct
auf die bessere Möglichkeit, unsere Glücksbedürfnisse zu be- friedigen,
die Quelle aller unserer Werthbegriffe. Jede Convariante, die
vollkommener war als eine andere, war somit — gleiche Bedingungen
vorausgesetzt — zugleich die im Kampf um’s Dasein stärkere. Hierauf
basirt ja überhaupt die darwinistische Erklärung der gesammten auf-
steigenden Entwickelung der Lebewelt. Es fragt sich nun aber, ist auch
umgekehrt jede Con- variante, die stärker ist als eine andere, zu
gleicher Zeit eine vollkommnere? Das sieht zuerst selbstverständlich
aus. Und doch kennen die Biologen Beispiele, wo eine bessere Anpassung
verbunden erscheint mit einer Vereinfachung des Functionen- systems des
Organismus. Hierauf fussend, haben einige Naturforscher, unter ihnen
besonders Nägeli Nägeli, C. Mechanisch physiologische Theorie der Ab-
stammungslehre. München und Leipzig 1884. S. 326 u. ff. — Vgl. auch
darüber Hauptmann, a. a. O. S. 344—349., Anpassungs- Vollkommenheit und
Organisations-Vollkommenheit von einander geschieden, und ausser der
durch den Kampf um’s Dasein regulirten Anpassung eine innere Tendenz
zur Vervollkommnung angenommen. Allein, es ist dagegen mit Erfolg
geltend gemacht worden, dass solche Beispiele rückgängiger Gesammt-
Organisation, wenn überhauptIn solchen Fällen entgeht der Beobachtung
eine etwaige grössere Complication der feineren Zellstructur wohl oft
und der Molekularstructur immer., nur sehr selten vorkommen, und dass
sie ausnahmslos dadurch charakterisirt sind, dass die betreffenden
Wesen in einen ganz eng umschriebenen, in seinen Bedingungen
einfacheren Umgebungskreis ge- bannt wurden, gleichsam in Sackgassen,
aus denen heraus eine Weiterentwickelung in grossem Styl nicht möglich
war. Ein Beispiel hierfür bietet uns der Olm (Proteus anguineus). Der
Olm ist ein blass fleischrother Molch, der in den unterirdischen
finsteren Gewässern des Karstes sein Wesen treibt. Er besitzt keine
ausgebildeten Augen wie andere Molche, sondern nur kleine dunkle
Pigmentkörnchen unter der Haut. Dies sind die Rudi- mente der
ausgebildeten Augen, welche die noch im Licht lebenden Vorfahren der
Olme besassen, und welche sich um so mehr zurückbildeten, je mehr sich
ein Theil dieser Vorfahren von den Eingängen der Höhlen immer tiefer in
die finsteren Räume hineinzog und dort Nahrung und Fortkommen mit Hülfe
anderer Sinne fand. Der darwinistische Mechanismus solcher Rückbildung,
die an einzelnen untergeordneten Organen auch beim Menschen vorkommt
(Zähne, Wurmfortsatz), besteht haupt- sächlich darin, dass unter den
wie bisher auftretenden Variationen des betreffenden Organs die
Besitzer der ge- ringeren Grade seiner Anlage nicht mehr durch den
Kampf um’s Dasein ausgemerzt werden, sondern sich unterschieds- los mit
den Besitzern höherer Grade sexuell mischen — Weismann’s Panmixie oder
Allesmischung — und daher ebenso gut durch die Fortpflanzung zur
Vererbung ihrer Eigenschaften, in diesem Fall ihres geringer ent- 7*
wickelten Organs, gelangen, wie die Besitzer der höheren Grade. Zum
leichteren Verständniss wollen wir uns vergegen- wärtigen, wie sich der
gewöhnliche Lebensprocess einer Art, z. B. der Vorfahren unserer Olme,
abwickelt. Dieser Lebensprocess bestand darin, dass im Frühling die
Molche, die den Winter überstanden hatten — 1. Generation, zur
Fortpflanzung schritten und eine Menge Laich absetzten — 2. Generation.
Von den darin enthaltenen Individuen, die zur einen Hälfte aus starken
und zur andern aus schwachen Convarianten bestehen möge, verfielen
während des Eier- und Larvenstadiums bis zur Begattungszeit im nächsten
Frühling ein gewisser Theil schwacher wie starker Con- varianten, sagen
wir von jeden ⅗, d h. 60 % aller Er- zeugten, nonselectorischen
Schädlichkeiten. Durch selec- torische Einflüsse wurde ein gewisser
anderer Theil, nämlich der Rest der schwachen Convarianten, also 20 %
der Er- zeugten, vernichtet oder an der Fortpflanzung gehindert. Der
übrigbleibende Theil der starken Convarianten, wiederum 20 % der
Erzeugten, repräsentirte die Auslese der ganzen zweiten Generation und
kam zum Laichen, also zur Production einer 3. Generation. Unter den neu
Erzeugten der dritten Generation fin- den wir, gerade wie bei der
zweiten, wieder einen Theil starke und einen anderen schwache
Convarianten, trotzdem die Eltern doch schon auserlesene Individuen
vorstellten, und man gemäss der Vererbung erwarten sollte, dass sie
gleich starke Devarianten erzeugen würden. Das beobach- ten wir in der
Natur aber nicht, sondern wir sehen bei fast allen Wesen, dass die
Gesammtheit der Eltern bei ihrer Fortpflanzung die Tendenz hat, die
Gesammtheit ihrer De- varianten schwächer werden zu lassen. Wir wollen
das absteigendes Variiren der Art nennen. Die Ausjätung durch den Kampf
um’s Dasein strebt. dann immer wieder, die schwächeren Devarianten von
der Fortpflanzung aus- zuschliessen und so bei den neuen Eltern das
Verhältniss von Starken und Schwachen in der alten Weise wiederher-
stellen, oder wenigstens nur in einem ausserordentlich ge- ringen Grade
günstiger zu gestalten. Denn aller Fortschritt in der organischen Natur
geht nur sehr, sehr langsam von Statten, so dass die Darwinianer stets
enorme Zeiträume für ihre behaupteten Umwandlungen in’s Feld führten.
Die Erzeugten der dritten Generation mögen also unter sich wieder etwa
50 % starke und 50 % schwache Conva- rianten zählen. Wiederum müssen
wir — wenn die Umgebung gleich bleibt — 60 % für den nonselectorischen
Abgang ansetzen, ferner 20 % für die Ausjäte und 20 % für die Auslese,
welch letztere in ähnlicher Weise starke und schwache Individuen zeugt,
wie die früheren Sieger u. s. w. Im Kampf um’s Dasein werden Individuen
mit mangel- haften Augen, die sowohl beim Ergreifen der Nahrung als
beim Fliehen vor Gefahren einen schweren Nachtheil be- dingen, einen
besonders schlimmen Stand gehabt haben, so dass Schlechtäugige unter
den starken Convarianten so gut wie gar nicht, dagegen unter den
schwachen häufig, nehmen wir an, zur Hälfte, vorkamen, d. h. unter den
ge- sammten Erzeugten waren immer 25 % mit mangelhaf- ten Augen. Nehmen
wir nun an, die sonnigen Gewässer, in denen unsere Molche leben, werden
zur Laichzeit plötzlich — meinethalben auf dem für die Krain ja nicht
ungewöhn- lichen Wege des Erdbebens — in unterirdische finstere Höhlen
versenkt. Bei den Höhlengenerationen ist es von jetzt an gleichgültig,
welche Beschaffenheit die Augen haben, ihre gute Ausbildung fördert
nicht, ihre schlechte schadet nicht. Für die Augen tritt Panmixie ein.
Die 25 % schlechtäugigen Convarianten kommen jetzt in dem- selben
Maasse leicht, schwer oder gar nicht zur Fortpflan- zung wie die
gutäugigen, so dass sich, ganz gleich, welche Beträge die
nonselectorischen und selectorischen Abgänge annehmen, auch unter den
Siegern 25 % mit schlechten Augen befinden werden. Diese Sieger
erzeugen nun die zweite Höhlengenera- tion. Vor dem Erdbeben hatten die
jedesmaligen Sieger, trotzdem sich unter ihnen keine Schlechtäugigen
befanden, schon immer zu 25 % schlechtäugige Nachkommen her-
vorgebracht. Jetzt werden die Sieger, die diesmal ja nur zu drei
Vierteln gute Augen haben und sich mit dem Viertel Schlechtäugiger
vielfach sexuell mischen, unter ihren Nach- kommen natürlich nicht
bloss 25 % schlechtäugige haben, sondern mehr, falls nämlich
Vererbungs- und Variations- Tendenzen gleich bleiben wie früher, woran
zu zweifeln wir keinen Anlass haben. Nehmen wir also an, es seien unter
den erzeugten Nachkommen, also der zweiten Höhlen- generation, nicht
25, sondern 30 % Schlechtäugige. Da beim Heranwachsen dieses
Geschlechts und seinem Kampf um’s Dasein die Augenbeschaffenheit
wiederum keine Rolle spielt, so werden unter den neuen Siegern bereits
30 % Schlechtäugige sein, also 5 % mehr als unter den Sie- gern der
ersten Höhlengeneration. Letztere zeugten 30 % Schlechtäugige, folglich
werden die Sieger der zweiten Generation aus denselben Gründen nicht
nur 30 %, sondern mehr, vielleicht 35 % Schlechtäugige hervorbringen u.
s. w. Hiermit ist erklärlich gemacht, wie die Vereinfachung der
Umgebung oder, was dasselbe ist, die Aufhebung des Kampfes um’s Daseins
für eines oder mehrere Organe die fortschreitende Entartung derselben
bedingen kann. In ähnlicher Art würde verständlich, wie bei möglichst
voll- ständiger Aufhebung des Kampfes um’s Dasein ein Nieder- gang
beinahe der gesammten Constitutionskraft erfolgen würde. Wir haben in
Obigem den gewöhnlichen Fall voraus- gesetzt, dass die im Kampf um’s
Dasein siegreichen Con- varianten bei ihrer Fortpflanzung nicht nur
gleich starke, sondern daneben auch schwächere Individuen erzeugen. Wie
aus unserer Herleitung hervorgeht, musste in jedem solchem Falle, auch
wenn die guten Eltern durchschnitt- lich nur ganz wenige schwächere
Devarianten stets mit er- zeugten, — wir nannten das absteigendes
Variiren der Art — der Rückgang nach Aufhebung des Kampfes um’s Dasein
mit Sicherheit eintreten, und zwar um so rascher, je grösser die
Tendenz zur Erzeugung schwächerer De- varianten war, und um so
langsamer, je kleiner diese Ten- denz war. Ganz ohne diese Tendenz,
also im Fall die erzeugten Devarianten durchschnittlich stets stärker
waren als die Eltern oder als der Durchschnitts-Typ der gleichaltrigen
Individuen der vorigen Generation — aufsteigendes Variiren der Art —
würde allerdings die Panmixie keinen Rück- schritt mehr hervorbringen
können, da eben das Variiren allein bereits das Fortschreiten besorgt.
Die rückschritt- liche Tendenz derselben würde in diesem Fall nur hin-
sichtlich der Zeit in Erscheinung treten, in so fern als sie den
Fortschritt erheblich verzögern würde. Darwin er- wähnt die Möglichkeit
des aufsteigenden Variirens von Arten ausdrücklich. (Entstehung der
Arten S. 113). Je- doch ist es in der Natur sicher nur selten. Wir
werden später bei der Besprechung des Schutzes der Schwachen auf diesen
Gegenstand zurückkommen. Ein mitwirkendes Moment bei der
Rückentwickelung eines nicht mehr ausgelesenen Organs ist der Vortheil,
den diejenigen Individuen bei der Selection haben, welche dies Organ
zwar in geringerer Anlage besitzen, aber die Ge- sammtheit ihrer
ontologischen Bildungskraft nicht in ent- sprechendem Maasse
verkleinert haben. Das relative Plus konnte anderen, nöthigeren Organen
zu Gute kommen und war also ein um so grösserer Vortheil im Kampf um’s
Dasein, je grösser es war, d. h. eine je mangel- haftere Entwickelung
das nicht mehr ausgelesene Organ besass. Bei unserem Olm, dem ein gutes
Auge in den finsteren Höhlen ebenso wenig etwas nützte, als ihm ein
schlechtes schadete, waren diejenigen Individuen im Vor- theil, bei
denen die Augen zu Gunsten anderer Sinnes- organe schlechter angelegt
waren. Denn diese anderen Sinnesorgane, Gehör, Geruch, Geschmack und
Gefühl, waren jetzt für das Fortkommen allein ausschlaggebend. Die
Verschlechterung einer Eigenschaft durch Pan- mixie ist also offenbar,
sobald es sich, wie gewöhnlich, um absteigendes Variiren der Art
handelt, und erklärt, wesshalb wir so manche Organe, die bei unseren
Vor- fahren in der Organismenreihe gut ausgebildet waren, überhaupt
nicht mehr oder nur noch in verkümmertem Zustand besitzen. Die Panmixie
kommt in zweierlei Arten vor. Zuerst in Bezug auf Regulationen, die
unnöthig werden, weil andere, neu aufgetretene stärkere Variationen sie
über- flüssig machen, und dann in Bezug auf Regulationen, die unnöthig
werden, weil die Umgebungs-Einflüsse einfacher geworden sind. Im ersten
Fall bewirkt die Panmixie nur für einen Theil des Organismus eine
Rückbildung, die jedoch Hand in Hand geht mit einer Gesammtverstärkung
der Constitutionskraft. Diese Art Panmixie findet statt bei den vielen
Regulationen, die das sich verbessernde Gehirn überflüssig macht,
hindert also nicht die Vervollkommnung überhaupt. Im zweiten Fall
bewirkt die Panmixie — immer das gewöhnliche absteigende Variiren der
Art vorausgesetzt — einen thatsächlichen Rückgang in der Organisation,
ein Zurücksinken von der erreichten Stufe der Vollkommen- heit, wenn
auch zugleich die gute Anpassung an einen einfacheren Umgebungskreis
aufrecht erhalten wird. Dieser zweite Fall sich erheblich
vereinfachender Um- gebung, der Grundbedingung einer Vereinfachung der
Structur, spielte bei der Entwickelung des Menschen bis in den Beginn
unserer Zeitrechnung hinein jedenfalls keine irgendwie in Betracht
kommende Rolle. Beim Menschen war jede stärkere Convariante auch
zugleich eine vollkom- menere. Denn sein fortwährendes Bestreben, sich
über die ganze Erde auszubreiten, sorgte immer wieder für neue, directe
Complicirung der Extral-Bedingungen. Ob dies für die neueste Zeit
anders geworden ist, ob neben dieser Complicirung noch stärkere
vereinfachende Factoren in Wirksamkeit getreten sind, wollen wir weiter
unten be- sprechen. Noch ein anderes Moment ist hierbei zu
berücksichtigen. Bei den sich rückentwickelnden Organismen war der
Kampf um’s Dasein fast ausschliesslich ein Extralkampf, der Soci-
alkampf spielte so gut wie gar keine oder nur eine kleine Rolle. Beim
Menschen war dies anders. Der Antheil des reinen Extralkampfes ist bei
ihm stetig zurückgegangen, während der des Socialkampfes, besonders
seit Ausbildung der Sprache und später der Waarenproduction, ganz ge-
waltig zugenommen hat. Nun ist aber, auch wenn die selectorischen
Extral- Factoren gleich bleiben, ja sogar, wenn sie milder werden,
durch das Andauern des Socialkampfes die Möglichkeit der Erhöhung der
durchschnittlichen Constitutionskraft ge- geben. Sobald z. B. selbst
das allereinfachste Ergreifen von Nahrung und von Wohngelegenheit nicht
direct, sondern erst nach einem Wettbewerb mit anderen Indi- viduen
erfolgen konnte, hatten diejenigen Convarianten, die in Bezug auf
diesen Socialkampf stärkere Regulations- Vorrichtungen, vor Allem
bessere Gehirne hatten, stets einen Vortheil vor den übrigen, konnten
die verfügbaren Nährstellen leichter occupiren und kamen eher zur Er-
zeugung und Aufziehung von Kindern und dadurch zur Vererbung ihrer
Eigenschaften. Die nächste Generation bildete also in Bezug auf alle im
Socialkampf zweck- mässigen Regulationen, vor allem auf das Gehirn,
eine Summe stärkerer Devarianten, sofern nur Variation und Vererbung
günstig waren. Daraus folgt, dass in dieser neuen Generation schon eine
etwas vollkommenere Or- ganisation nöthig war, um der Gesammtheit eine
Nähr- stelle abzuringen, als in der vorigen. So konnte der So-
cialkampf ohne sonstige Verschärfung der Extraleinflüsse für eine
Vervollkommnung hervorragend mitwirken, ein Moment, das auch für die
bessere Anpassung an die Ex- traleinflüsse deshalb von Bedeutung war,
weil im allge- meinen die Sieger im Socialkampf durch ihre besseren
Gehirne zugleich eine gute Waffe für den Extralkampf besassen. Hierin
liegt ein Grund, warum der Social- kampf auch von Wichtigkeit ist für
die einfache Vermehrung einer Rasse, die sich ja um so mehr ausbreitet,
je besser sich ihre Individuen der Umgebung anpassen. Selbst die
vereinfachten Extraleinflüsse bewirken aber noch lange keine
Gesammtvereinfachung aller selectorischen Factoren, da die
selectorischen Socialwirkungen ganz vor- wiegend der Auslese die
Richtung geben. Nur bei einer Milderung dieses Socialkampfes, z. B.
durch eine sehr geringe Geburtenziffer (Frankreich), kann überhaupt von
einer wesentlichen Gesammt-Vereinfachung der äusseren Wirkungen
gesprochen werden. Nach den bisherigen Ausführungen sind demnach für
den Menschen vollkommnere und stärkere Variante identisch, wenigstens
für den Begriff, den wir im Anfang des Capitels mit dem Worte
Vervollkommnung verbunden haben. Aber erschöpft dieser Begriff auch
alles das, was man sich gewöhnlich unter dem Wort vorstellt? Lassen wir
einmal verschiedene einzelne Eigenschaften Revue passiren, die einen
Menschen vollkommener er- scheinen lassen als einen anderen, und die
auf den ersten Blick nichts mit der Stärke oder Schwäche des
Individuums im Kampf um’s Dasein zu thun haben. Intelligenz, kräftige,
gewandte Musculatur, gute Verdauung, Widerstandskraft gegen
Witterungs-Einflüsse und Ähnliches sind Eigenschaften, deren Verbindung
mit der Erhaltungs- oder Fortpflanzungs- kraft auf der Hand liegt. Aber
ist diese Verbindung auch vorhanden z. B. bei der Schönheit der
Gesichts- und Körperformen? Ganz offenbar. Ein schönes Mädchen wird
eher zum Weibe begehrt als ein hässliches Mädchen, hat also eher
Gelegen- heit Kinder zu zeugen; Entsprechendes gilt für einen im Sinne
der Frauen schönen Mann. Aber auch in sehr vielen anderen Beziehungen
und im oekonomischen Wettkampf ist ein sogenanntes „angenehmes
Aeussere“ ein gewichtiger Empfehlungsbrief. Besitzer widerwärtiger
Gesichter werden mir das sofort bestätigen. Selbst bei der Pflege der
Kinder spielt deren Aeusseres eine Rolle. Hübsche Kinder werden nicht
nur oft von den Eltern, sondern auch von den Lehrern und anderen
Menschen vorgezogen. Aus allen diesen Gründen sind angenehme äussere
Formen ganz direct eine Waffe im Socialkampf. Wesshalb wir Gefallen
grade an einigen Gesichts- und Körperformen finden und an anderen
nicht, hat für manche derselben eine sehr augenfällige Grundlage. Viele
Form- charaktere sind Correlationen der Fortpflanzungsorgane im
weitesten Sinne. Ein vollbusiges Weib gefällt den Männern, weil der gut
entwickelte Busen eine bessere Säugung der Kinder garantirt, und weil
diejenigen Männer, die flach- brüstige Frauen geheirathet haben, in
ihren schlechter ge- nährten Kinder eher mitsammt ihrer Geschmacks-
richtung ausgejätet wurden. Dieselbe Beziehung der schönen Form zur
Güte der Fortpflanzungsorgane besteht zwischen dem breiteren Becken und
einer ungestörten Geburt; den durch ein gewisses Fettquantum wohl ge-
rundeten äusseren Körperformen und der für die Schwanger- schaft und
die Säugungsperiode bedeutungsvollen Er- nährungskraft; der grösseren
Sanftheit und Anmuth der Bewegungen und der liebevollen Kinderspflege,
u. s. w. Beim Manne ist’s ähnlich. Wenn die Frauen im Allgemeinen etwas
magere, muskelkräftige, intelligente Männer mit muthigem
Gesichtsausdruck schöner finden als fette, schwache mit dummem oder
feigem Ausdruck, so liegt der Grund darin, dass Männer der ersten Sorte
eher im Stande waren, für Nahrung zu sorgen und Weib und Kinder vor
Gefahren zu beschützen. Frauen, die an Männern der zweiten Sorte
Geschmack fanden, oder die auch nur indifferent bei der Geschlechtswahl
waren, liefen oft Gefahr, in ihren Kindern mitsammt ihrer
Geschmacksrichtung im Kampf um’s Dasein ausgejätet zu werden. Dies geht
noch weiter. Der Geschmack bei der sexuellen Zuchtwahl musste sich
nicht nur in der Richtung der besseren Fortpflanzungskraft ausbilden,
sondern auch in der Richtung der besseren individuellen
Erhaltungskraft. Denn bei geringer Erhaltungskraft, Schwäche,
Kränklichkeit und Tod eines der Eltern kam nicht nur die Zulänglichkeit
und richtige Zeitdauer der Kinderpflege in Gefahr, sondern der
schlechte Elter hatte ausserdem noch die Tendenz, seine schwache
Erhaltungskraft den Kindern zu vererben, so dass durch deren leichtere
Ausjätung der andere Elter, der schlecht gewählt hatte, oft mit
ausgejätet wurde. Die natürliche Auslese gab also schliesslich der
sexuellen Auslese die Directive, die ganz im Allgemeinen auf die
stärkere Gesammt-Constitutionskraft gerichtet war. Mit anderen Worten:
das eine Geschlecht findet im Grossen und Ganzen die starken
Convarianten des andern Geschlechtes schön, die schwachen dagegen
weniger schön bis abstossend. In wie hohem Grade unser Schönheitsgefühl
an die Entwickelung unserer Geschlechtsorgane gebunden ist, also zu den
Sexualfunctionen gehört, können wir aus der be- kannten Thatsache
entnehmen, dass bei früh Castrirten der Schönheitssinn sich nur
äusserst schwach oder gar nicht entwickelt. Der Grund, weshalb wir
sonst, abgesehen von den geschlechtlichen Beziehungen, Leute mit
hübschen Gesich- tern vorziehen, ist der, dass hinter solchen Formen
sich im Grossen und Ganzen eher sympathische und nützliche Charaktere
verbergen als hinter hässlichen Gesichtern. Ausnahmen kommen natürlich
vor, ändern aber nichts an an der Regel. Lombroso macht einige
interessante An- gaben hierüber (Der Verbrecher. Deutsch von Fränkel.
Hamburg 1887. S. 243 u. ff.): „Einen wirklich Ehrlichen mit
vollständigem Verbrechertyp habe ich unter 400 Indi- viduen nur einmal
gefunden .... So muss ich denn sagen, dass die typische
Verbrecher-Physiognomie nur aus- nahmsweise bei ehrlichen Leuten und
fast regelmässig bei unehrlichen vorkommt .... Das instinctive Erkennen
des Verbrechertypus ist eine schwer zu erklärende That- sache.
Zweifellos giebt es aber Personen besonders unter den Frauen, die diese
Gabe in hohem Grade besitzen und auf dem Widerwillen, den sie beim
ersten Anblick gewisser Physiognomien empfinden, ihr meist zutreffendes
Urtheil begründen .... Dem unwillkürlichen, aber allgemeinen
Bewusstsein, dass es einen dem Verbrecher eigenthümlichen
Gesichtsausdruck giebt, verdankt man die Bezeichnungen: „Spitzbuben-,
Mördergesicht“ u. s. w. … Wie soll man aber dieses unwillkürliche
Bewusstsein erklären? … Ich vermuthe, dass dahinter eine vererbte
Erscheinung steckt. Der Eindruck, den unsere Väter unsern Kin- dern
hinterlassen haben, ist gleichsam zum unbewussten Wahrnehmen geworden,
ähnlich demjenigen der kleinen Vögel, die in unseren Wohnungen gross
geworden, vor Schreck mit Flügel und Schnabel gegen die Gitter des
Käfigs schlagen, wenn sie einen Raubvogel vorüberfliegen sehen, der
nicht ihnen, sondern nur ihren Voreltern bekannt gewesen ist .... Die
Untersuchung von 800 ehrlichen Leuten hat uns ergeben, dass
Degenerationszeichen in der Gesichtsbildung auch bei ihnen zwar
vorkommen, aber niemals so viele auf einmal wie bei Verbrechern, und
dass wenn es je der Fall ist, der Verdacht auf eine versteckte böse
Leidenschaft oder auf cretinartige Degeneration ge- rechtfertigt
erscheint. Die Beobachtung am Lebenden be- stätigt endlich, wenn auch
weniger sicher und constant als die an der Leiche, das häufige
Vorkommen von Mikro- cephalie, Asymmetrie, Schrägheit der Augenhöhlen,
Vor- springen der Kiefer, Auftreibung der Stirnhöhlen. Sie hebt neue
Thatsachen von Ähnlichkeit zwischen Irren, Wilden und Verbrechern
hervor.“ Nun fährt im Allgemeinen derjenige Mensch im Kampf um’s Dasein
besser, der Geschmack an äusseren Formen hat, deren Besitzer, wie z. B.
altruistische Naturen, seinem Lebensprocess förderlich sind, woraus
sich die allmähliche Züchtung unseres Geschmacks in der bestimmten vor-
liegenden Richtung erklärt. Erklärt wenigstens in darwini- stischem
Sinne. Weshalb nun grade diese bestimmte Form an jenen bestimmten
Charakter gebunden ist, das ist uns ebenso sehr ein Geheimniss, als
warum grade die und die Anordnung der Zellen in einem Organ an die und
die bestimmte Function gebunden ist. Wir müssen uns da- bei beruhigen,
dass Function und Form feste Beziehungen zu einander haben, von deren
Erkennen wir noch weit ent- fernt sind. So sehr es für die überwiegende
Mehrzahl schöner Eigenschaften einleuchtet, dass sie in irgend einer
Bezie- hung zur grösseren Erhaltungs- oder Fortpflanzungskraft der
Individuen, also ihrer Constitutionskraft stehen, so haben wir doch
keinen Grund abzuläugnen, dass es ge- wisse Theile der menschlichen
Schönheit gibt, die beson- ders bei der geschlechtlichen Auslese von
dem anderen Geschlecht nur gewählt werden, weil sie einem Schönheits-
bedürfniss entsprechen, das seine Entstehung nicht der Nützlichkeit der
Function verdankt, die etwa an den schönen Theil geknüpft ist, sondern
das mit der Bewegungsart der lebendigen Substanz oder der Substanz
überhaupt auf’s Engste verbunden ist. Ich erinnere an Helmholtz’
Erklär- ung einiger elementaren aesthetischen Empfindungen, wie
Linien-, Farben- und Tonharmonien, als Gefallen an ein- fachen
mathematischen Verhältnissen. Solche Schönheitsempfindungen ohne Bezug
auf die Constitutionskraft fallen nicht sehr in’s Gewicht; das lehren
uns die Castraten, bei denen der Sinn für Schönheit in eben- so
geringem Grade entwickelt ist wie andere secundäre
Geschlechtscharaktere. Dementsprechend werden auch die Theile der
menschlichen Schönheit, die einzig für solche beziehungslosen
Schönheits-Empfindungen das Material lie- fern, keinen grossen
Procentsatz der gesammten mensch- lichen Schönheit ausmachen. Aber
selbst dieser Antheil ist im Kampf um’s Dasein, wenn auch nur im
socialen, keineswegs gleichgültig, sondern wird stets für seinen Be-
sitzer einen Vortheil darstellen und ihn als Convariante stärken. Denn
seine Artgenossen machen sich keine Ge- danken darüber, welcher Art und
Herkunft die Schönheit ist, die sie vorfinden und an der sie sich
erfreuen. Aus obigen Sätzen geht hervor, dass der Schönheits- sinn im
Lauf der Entwickelung für uns zu einem bisher noch jeder Wissenschaft
überlegenen Maassstab geworden ist, die Stärke einer Convariante im
Extral- und Socialkampf ganz instinctiv abzuschätzen. Nur der zuletzt
erwähnte kleine Theil des Schönheitssinns ist insofern beschränkter,
als er uns nur einen Massstab für die Stärke im socialen Kampf, nicht
für die im extralen liefert. Wenigstens wissen wir über diesen letzten
Punkt nichts. Die menschliche Schönheit kann uns somit noch nicht
veranlassen, die Vollkommenheit und die Stärke der Va- rianten als
etwas Verschiedenes zu betrachten. Eine andere Seite der
Vollkommenheit, deren Ver- knüpfung mit dem besseren Fortkommen im
Kampfe um’s Dasein zweifelhaft sein könnte, ist der Altruismus, die
Güte. Diejenigen Convarianten, die starke altruistische Anlagen mit auf
die Welt bekommen haben, scheinen gegenüber den berechnenden Egoisten
im Socialkampf sogar benach- theiligt. Etwas Wahres ist sicher daran.
Es ist kein Zweifel, dass mancher rücksichtslose Streber, Wucherer,
Fabrikant, und wer sonst noch, wie sich einmal Jemand ausdrückte, zu
der Firma Wolfau und Gemeinke gehört, durch seinen Egoismus einen
gewissen Vortheil im Kampf um’s Dasein auf seiner Seite hat. Allein dem
gegenüber sind doch auch sehr starke Nachtheile mit solcher
Gemüthsdisposition verbunden, wenn sie nicht auf anderem Gebiete, als
grade dem ökonomischen Kampf, Hand in Hand geht mit einer ziemlich
grossen Dosis von Altruismus. Wer nicht alt- ruistisch für Weib und
Kinder fühlt, wird immer in Bezug auf Erfolg bei der Kinderpflege
hinter dem liebevollen Vater zurückstehen. Wer seinen Freunden nicht
hilft, wird auch von ihnen in der Noth verlassen. Das Volk, das wenig
aufopferungsfähige Männer und Frauen besitzt, wird im Kampf mit einem
anderen Volk, das deren viele hat, bei sonst gleichen Umständen
leichter unterliegen. Ein allzu sehr ausgeprägter Egoismus kann
unmittelbar zum Verbrechen und dadurch in die Hände der Justiz führen,
die dann mehr oder weniger gründlich den Ausjätungsprocess übernimmt.
Im Grossen und Ganzen ist demnach, abgesehen von allzu hohen,
selbstzerstörenden Graden, die man wohl kaum als Vollkommenheit
bezeichnen wird, die Güte für ihren Be- sitzer ebenso sehr eine Waffe
im Socialkampf wie schöne äussere Formen. Man könnte dann noch
zweifeln, ob hohes Alter als ein günstiger Factor im Kampf um’s Dasein
anzusehen sei, da das hohe Alter keine Bedeutung mehr für die Fort-
pflanzungs-Functionen habe. Hierauf ist zu erwidern, dass erstens
Pflege und Schutz der Kinder durch die Eltern oft bis in ein ziemlich
hohes Alter derselben hineinreichen, und dass zweitens ein hohes Alter
nur die Folge einer grossen Erhaltungskraft ist, die in jüngeren Jahren
für den günstigen Ablauf der Fortpflanzung und Kinderpflege von der
grössten Bedeutung war. Je kräftiger die Consti- tution in der Jugend,
desto länger glimmt im Alter das Lebenslämpchen, ehe es verlöscht. Wir
könnten noch verschiedene Seiten der Vollkommen- heit zu den Aussichten
ihrer Träger im Kampf um’s Da- sein in Beziehung setzen und würden
überall erkennen, dass sie in ähnlicher Weise mit dem Erfolg verknüpft
sind, und also ihre Träger in ähnlicher Weise zu stärkeren Con-
varianten machen, als wir es bei der Schönheit, dem Al- truismus und
dem hohen Alter gesehen haben. Das Volk hat eben seinen Begriff von
menschlicher Vollkommenheit aus solchen Erfolg versprechenden
Eigenschaften aufgebaut. Dass manche Autoren trotzdem häufig von einem
Zugrunde- gehen vollkommnerer Individuen im Kampf um’s Dasein reden,
hat zum Theil seinen Grund darin, dass sie ver- gessen, dass ein guter
Theil der vollkommneren Conva- rianten durch nonselectorische
Schädlichkeiten vernichtet wird, also durch Factoren, die mit den
ausjätenden selec- torischen ebenso wenig zu thun haben, wie mit dem
Kampf um’s Dasein. Der Process der Vervollkommnung ist also beim Men-
schen durchaus nicht verschieden von dem überall in der Thierreihe
beobachteten Process der besseren Anpassung an die Extral- und
Socialumgebung, der charakterisirt ist durch das Auftreten stärkerer
Typus-Devarianten, d. h. von Erzeugten, die durchschnittlich stärker
waren als die Er- zeugten der vorhergehenden Generationen, durch die
Auslese der jedesmaligen stärkeren Convarianten, d. h. der Individuen,
die im Vergleich zu den ihnen gleichaltrigen erfolgreicher im Kampf
um’s Dasein waren, und durch die Vererbung der dabei zum Sieg helfenden
Eigenschaften auf die erzeugten neuen Devarianten. Im vorigen Satz
kann, was den Menschen anlangt, überall statt stärker vollkommener und
statt schwächer 8 unvollkommener gesetzt und damit der darwinistische
Mecha- nismus seiner Vervollkommnung bezeichnet werden. Wir wollen nun
für später die Bezeichnung stark und schwach für die Varianten fallen
lassen, und für die langen Worte „vollkommen“ und „unvollkommen“
einfach „gut“ und „schlecht“ setzen. — Das Zeichen der Vervollkommnung
einer Rasse von einer Generation zu einer andren müsste darin bestehen,
dass in der letzten Generation die sieghaften reifen Conva- rianten
durchschnittlich besser waren als dieselbe Classe Convarianten der
früheren Generation. Rassenhygienische Forderungen für Vervollkommnung
und Vermehrung. Die bisherigen Bedingungen der Vervollkommnung oder
Verbesserung einer Rasse waren, wie wir sahen, fol- gende: Auftreten
von durchschnittlich besseren Devarianten, Ausjätung des Theils von
ihnen, der schlechtere Convarianten repraesentirt, und häufige
Vererbung der Variationen, auf Grund deren der Sieg errungen wurde.
Selbstverständlich erscheint es nöthig, diese bisherigen Bedingungen
auch für die Zukunft aufrecht zu erhalten, wenn eine weitere
Verbesserung stattfinden soll. Es fragt sich nur, wie müssen diese drei
Factoren am besten zu- sammenwirken, um eine Rasse möglichst rasch zu
grösserer Vollkommenheit zu führen. Die rassenhygienischen Forderungen
hierfür wären: 1) Möglichst zahlreiches und intensives Auftreten
besserer Devarianten; der Vergleich darf natürlich nur bei Devarianten
von gleichem Alter und Geschlecht angestellt werden, so dass
Neugeborene nur mit dem Status der Eltern verglichen werden können, den
diese selbst als Neugeborene hatten. 2) Solche Extral- und
Socialeinwirkungen, dass frühe und vollständige Ausjätung desjenigen,
schlechteren Theils der Convarianten stattfindet, der gemäss der
erreichbaren Summe der Lebens- bedingungen für die gesammte Rasse doch
nicht aufkommen würde. 3) Keine Contraselection, d. h. keine besondere
Schädigung gerade der besseren und kein besonderer Schutz grade der
schlechteren Convarianten. In Bezug auf die reine Vererbung werden wir
nie eine Forderung stellen können; sie ist nur ein Punkt zwischen
Variation nach der besseren und der schlechteren Seite, und höchst
wahrscheinlich ein biologisches Gesetz, wie das Fallgesetz ein
physikalisches. Vergleichen wir mit diesen Forderungen diejenigen,
welche wir auf S. 65 für die Vermehrung der Zahl gestellt haben, so ist
die Forderung der Erhöhung der Constitutions- kraft dieselbe wie unsere
erste Forderung besserer De- varianten; die Forderung der Verminderung
der Contra- selection ist ebenfalls dieselbe. Die Forderung der Ver-
minderung der nonselectorischen Schädlichkeiten in einer Rasse kann
ebenfalls für unsere Vervollkommnung erhoben werden, da ein grosser
nonselectorischer Abgang nicht nur eine Verminderung der
Variations-Möglichkeiten bedingt, unter denen sich ja Möglichkeiten für
neue Richtungen der Entwicklung befinden könnten, sondern ausserdem
auch noch durch die Nothwendigkeit des Wiederersatzes die Zahl der
Geburten erhöht und es dadurch nöthig macht, das mehr Kinder höherer
Nummern in der Geburtenreihen- folge erzeugt werden, Kinder, die wir
auf S. 59 als minder- werthig erkannten. Die Forderung der Milderung
der selectorischen Ein- flüsse können wir nur insofern dulden, als es
sich um Schädlichkeiten handelt, die eine dauernde Beseitigung für alle
Zukunft erfahren. Für solche Schädlichkeiten nämlich würde unsere
Constitutionskraft nur ein bedeutungs- loses absolutes Herabgehen
erfahren, aber kein relatives, da wir für eine Schädlichkeit die
dauernd gehoben worden, auch keinen Regulations-Mechanismus mehr
brauchen. Wenn 8* die Beseitigung einer solchen Schädlichkeit dagegen
nicht für die Dauer Platz griffe, so würde das bei der gewöhn- lichen
absteigenden Variations-Neigung durch Panmixie herunter gegangene Organ
der erneut hereinbrechenden Schwierigkeit nicht mehr gewachsen sein,
und die Rasse hätte von ihrer Constitutionskraft verloren. Ausserdem
darf eine solche Beiseitigung von Schädlich- keiten nur sehr partiell
stattfinden, keineswegs aber darf sich die Gesammthöhe der schädlichen
äusseren Ein- wirkungen verringern. Im Gegentheil, wenn die Vervoll-
kommnung der Rasse rasch von Statten gehen soll, muss eine so scharfe
Ausjäte Platz greifen, wie sie nur im Interesse der Individuenzahl, d.
h. des Kampfes der Rasse mit anderen Rassen, erlaubt ist. Die
combinirte Forderung der Rassenhygiene in Bezug auf die rasche
Vermehrung der Zahl und auf die möglichst rasche Vervollkommnung
besteht also dem Wesen nach in der Forderung der Vermehrung der reifen
guten Convarianten in der nächsten Generation und Erhöhung ihres
durchschnittlichen Gütegrades, beides verglichen mit den reifen guten
Convarianten der alten Generation. Zur Erfüllung ist nötig: 1)
Erzeugung möglichst vieler besserer Devarianten. 2) Scharfe Ausjätung
des schlechteren Theiles der Convarianten, dessen Grösse im richtigen
Verhältniss stehen muss zu der Differenz zwischen erzeugten Individuen
und erreichbaren Nährstellen. Keine Erleichterung der Gesammt- grösse
der selectorischen Einflüsse. 3) Keine Contraselection, d. h. keine
Ausmerzung grade der guten und kein besondrer Schutz grade der
schlechten Convarianten; also keine Kriege, keine blutigen
Revolutionen, kein besonderer Schutz der Kranken und Schwachen. — Bei
diesen Herleitungen sind solche Variationen bisher unberücksichtigt
geblieben, die bei allen Devarianten zu- gleich in einem gewissen
gleichen, wenn auch bei einem Theil in höherem Grade auftreten. Man
könnte an solche Möglichkeit bei bestimmten Einwirkungen eines
Klimawechsels denken. Da dann die Convarianten in dem gewissen Grade
der betreffenden Variation gleich wären, so würde unter ihnen ein Kampf
um’s Dasein wegen diesem Grade der Eigenschaft nicht eintreten. Dieser
bestimmte Grad würde also keine Verstärkung oder Abschwächung von
Convarianten bedingen. Für die Devarianten jedoch könnte dieser Grad
eine Verstärkung oder eine Abschwächung bedeuten, je nach der
Veränderung ihrer Constitutions- kraft. Für beide Fälle ist in den
obigen Forderungen gesorgt. Denn die Verstärkung der Devarianten sowohl
wie ihre Abschwächung ist berücksichtigt in der Forde- rung „Erzeugung
möglichst vieler besserer Devarianten.“ Schreiten wir noch fort? Ehe
wir unsere Forderungen weiter analysiren, wollen wir einen Blick auf
den gegenwärtigen Stand der Cultur- völker werfen in Hinsicht auf die
Frage, ob sie sich in der letzten Zeit vervollkommnet haben, oder ob
sie zurück- geschritten sind. Wie bekannt, gehen die Ansichten darüber
weit aus- einander. Einige Autoren sind grade so sehr von der
Fortentwickelung unseres Typus überzeugt, wie die an- deren vom
Stillstand oder Rückschritt. Ab und zu ge- stehen einzelne zu, sich
kein Urtheil darüber bilden zu können. Ausserdem sind die Meinungen
auch verschieden, je nachdem die herangezogene Vergleichszeit von der
Gegenwart sehr entfernt ist oder ihr nahe liegt. Im allgemeinen stehen
auf Seite derer, die den Fort- schritt annehmen, Ammon, Darwin in
seinen jüngeren Jahren, Haeckel, Samson-Himmelstjerna und viele andere
Biologen, auf Seiten der Zweifelnden Darwin in seiner späteren Zeit,
Galton, Kollmann, Olge, Hiram Stanley, Tille, Wallace und Andere, unter
ihnen viele Socialisten, die sich direct auf die degenerirenden
Wirkungen des Capitalismus berufen. Wir wollen sehen, ob wir im
Einklang mit unseren bisherigen Betrachtungen zu einem Schluss kommen
können. Vor allem müssen wir die beiden Fragen auseinander halten,
erstens, ob in den letztverflossenen grossen Zeit- räumen, sagen wir
einmal ein bis zwei Jahrtausenden, eine Vervollkommnung unseres Typus
zu Stande gekommen ist, und zweitens ob ein solche Vervollkommnung auch
noch in der jüngsten Zeit andauert. Bei der ersten Frage handelt es
sich also darum, ob wir nachweisen können, dass der Durchschnittsgrad
von Vollkommenheit bei den Culturrassen, d. h. bei den West- ariern,
seit dieser letzten Zeit, also seit einem bis zwei Jahrtausenden,
höhere Werthe angenommen hat. Nach Allem, was wir im Lauf dieses
Capitels über Vervollkommnung gesagt haben, die wir als gleichbedeutend
mit Erhöhung der Gesammt-Constitutionskraft in Bezug auf den Extral-
und Socialkampf erkannten, scheint ein Weg vorzugehen, folgender: Wir
bestimmen die Summe der nonselectorischen und selectorischen Einflüsse
in beiden Zeiten und vergleichen dann die mittlere Lebensdauer der
Individuen zu denselben Zeiten. Wenn wir die äusseren Einflüsse gleich
fänden, so wäre die mittlere Lebensdauer ein Maassstab für die
durchschnittliche Constitutionskraft, vorausgesetzt, dass die
Durchschnittszahl der Geburten für eine Mutter gleich wäre, und dass
die Kinder in durchschnittlich gleichen Altersjahren der Eltern erzeugt
würden. Diese beiden letzteren Einschränkungen sind nothwendig, da
nicht nur die Reihenfolge bei der Geburt, sondern auch das Alter der
Eltern bei der Zeugung auf die Constitutionskraft der Kinder einen ganz
bedeutenden Einfluss ausübt. Der Leser sieht jetzt schon, welche
grossen Schwierig- keiten die Beurtheilung aller dieser einzelnen
Momente verursachen würde. Aber nehmen wir einmal an, die Zahl der
Kinder einer Mutter und das Alter der Eltern bei der Zeugung sei heute
und im Alterthum so ziemlich gleich. Dann handelt es sich immer noch um
die Feststellung, ob die äuseren Einflüsse gleich geblieben sind, oder
ob sie milder oder schärfer geworden sind. Erst wenn wir auch hier
constatiren können, dass sie sich nicht wesentlich verändert haben,
dürften wir aus der ziemlich allgemein angenommenen Erhöhung der
mittleren Lebensdauer auf eine Erhöhung der Constitutionskraft
schliessen. Könnten wir sogar erweisen, dass die äusseren Einwirkungen
heute mannigfaltiger und ungünstiger sind als damals, so wäre die
jetzige höhere Lebensdauer erst recht ein Zeichen der Vervollkommnung.
Wenn wir uns dagegen überzeugen müssten, dass die äusseren Bedingungen
einfacher und leichter geworden sind, dann fehlt uns, im Fall wir den
Grad der Erleichterung nicht messen können, jeder An- halt für eine
Beurtheilung der Constitutionskraft durch die Lebensdauer. Denn bei
Erleichterung oder Vereinfachung der Bedingungen kann die mittlere
Lebensdauer sogar bei Verringerung der Constitutionskraft noch steigen,
wenn nämlich die Bedingungen in verhältnissmässig noch stär- kerem
Masse einfacher geworden sind, als die Constitutions- kraft sich
verschlechterte. Es fehlt uns dann jede Berechti- gung, die mittlere
Lebensdauer für den Nachweis einer Verbesserung unserer Rasse zu
verwenden. Es handelt sich demnach zuerst um die Entscheidung der
Vorfrage, ist die Gesammtheit der ausseren Einwir- kungen nicht etwa
einfacher, milder geworden. Wie wir früher sahen, haben Extral- wie
Socialeinflüsse bei der Ver- vollkommnung mitgewirkt, wir müssen also
beide in den Vergleichszeiten prüfen. Die extralen, d. h. die nicht in
irgend einer Art durch die gleichzeitig existirenden Individuen
vermittelten Ein- wirkungen haben sich zwar unzweifelhaft theilweise
ein- facher gestaltet. Die grossen Agentien der Natur, Licht, Luft,
Sommerwärme, Winterkälte, Nässe etc. sind allerdings wohl kaum sehr
wesentlich von denen des Alterthums ver- schieden. Allein eine ganze
Reihe specieller Extralfactoren sind doch durch die Arbeit früherer
Generationen gemildert worden. So ist z. B. der Aussatz, der früher
zahlreiche Opfer forderte, so gut wie ganz bei uns ausgetilgt worden.
Die Ansteckungsgelegenheit durch Pocken ist durch die Impfarbeit der
vorigen Generation stark zurückgegangen, die durch verschiedene andere
Krankheiten erheblich be- schränkt worden. Jedoch allen solchen
Erleichterungen der Extralbeding- ungen stehen die grossen
Complicationen gegenüber, die die Lebensbedingungen der Westarier als
Gesammtheit da- durch erfahren haben, dass sie sich allmählich von
ihren alten Wohnsitzen in Europa über beinahe die ganze Erde verbreitet
haben, hauptsächlich natürlich über die beiden Amerika und Australien,
wobei stets eine lebendige Ver- bindung mit den Mutterländern durch
Zwischenwande- rung und Mischehen aufrecht erhalten wurde. Die Compli-
cation der Extraleinflüsse durch Klima, endemische Krank- heiten,
Veränderung der Nahrung etc. scheint doch so gross, dass die
Vereinfachung der Bedingungen durch die Residuen der Culturarbeit
früherer Geschlechter nicht so ohne Weiteres ein entsprechendes
Gegengewicht zu bieten scheint.Vgl. Ratzel, Anthropo-Geographie.
Stuttgart 1882, bes. Cap. 5. S. 87. Man sieht leicht, wie schwierig, ja
bei unseren heuti- gen Kenntnissen unmöglich es ist, über die
Veränderungs- grösse der Extraleinflüsse irgend etwas zu äussern, was
mehr Werth als eine blosse Vermuthung beanspruchen darf. Was die
Socialeinflüsse anlangt, so könnte man gel- tend machen, dass sie im
allgemeinen um so stärker wür- den, je grösser die Geburtenrate minus
dem Geburtenüber- schuss, also je grösser die Sterberate ist, da die
Extralaus- jäte gegenüber der socialen so wenig in Betracht kommt.
Allein dies gilt vor allem von der Jetztzeit, früher lag das
Verhältniss mehr zu Gunsten des extralen Theils. Wir müssen hier unsere
Unfähigkeit bekennen, einen brauch- baren Vergleich anzustellen und
überlassen die Arbeit den Historikern der Medicin und der Cultur im
Allgemeinen. Nur Eines kann man mit einiger Sicherheit behaupten, dass
nämlich in den letzten Jahrhunderten die Gesammt- heit der
Lebensbedingungen für die westarischen Völker entschieden leichter, d.
h. einfacher für unsere Constitu- tionskraft geworden sind. Denn ein so
bedeutendes An- steigen der mittleren Lebensdauer, wie es thatsächlich
in den letzten Jahrhunderten beobachtet worden ist, kann aus allgemein
biologischen Gründen nicht in ihrer ganzen Grösse auf eine
entsprechende Vervollkommnung der Constitutions- kraft bezogen werden.
Bei allen Lebewesen, die nicht einer künstlichen, son- dern nur der
natürlichen Zuchtwahl unterworfen sind, be- obachten wir direct, wenn
es uns überhaupt möglich ist, keinen oder nur einen sehr geringen
sichtbaren Fortschritt in der Entwickelung. Das ist ja grade einer der
Gründe gewesen, weshalb die Darwin-Wallace’schen Theorien sich so
langsam Bahn gebrochen haben, und weshalb alle Darwinianer so gewaltige
Zeiträume für grössere Umwand- lungsprocesse in Rechnung setzen. Wenn
wir beim Menschen dasselbe Verhältniss anneh- men, so bedeuten ein paar
Jahrhunderte eine lächerlich kurze Zeit für eine nur einigermaassen
deutlich merkbare Vervollkommnung, d. h. Erhöhung der
Regulationskräfte. Deshalb sind wir gezwungen, wenn wir einer sehr
bedeu- tenden Zunahme der mittleren Lebensdauer in den letzten
jahrhunderten gegenüberstehen, als Hauptgrund eine Er- leichterung der
Gesammtheit der selectorischen und nonse- lectorischen Einwirkungen
anzunehmen. Der bekannte Statistiker KolbCulturgeschichte des Menschen.
III. Aufl. Leipzig 1885. S. 35. führt in Bezug auf die Veränderung der
mittleren Lebensdauer Folgendes aus: „Gleichwohl lassen die
nachstehenden wie die obigen Rech- nungsergebnisse, mögen sie auch im
Einzelnen mehr oder minder unsicher sein, wenigstens im Allgemeinen, im
Gro- ssen und Ganzen, die Richtung erkennen, in der eine Aen- derung
stattfand. Sie zeigen, dass, wenn auch das Lebens- alter der Greise
dermalen kein höheres sein mag, als es vor Jahrtausenden gewesen,
jedenfalls eine weit grössere Verhältnisszahl der Geborenen das
mittlere und das Greisen- alter erreicht. Auf Grundlage der Rechnungen
englischer Tontinen- gesellschaften ermittelte Finlaison die
wahrscheinliche künf- tige Lebensdauer folgendermassen: Am
auffallendsten zeigt sich der Unterschied in den zwei ersten
Lebensjahren.“ Kolb berechnet, dass in Lon- don die Sterblichkeit für
die beiden ersten Lebensjahre im Anfang des 19. Jahrhunderts nur ein
Drittel von der Sterb- lichkeit derselben Lebensjahre im Anfange des
18. Jahr- hunderts betrug. „Eine mehr als gewöhnliche Verlässlichkeit
besitzen die Notizen, welche aus der Stadt Genf vorliegen. Von 1000
Kindern starben: Während des 16. Jahrhunderts starben zu Genf im ersten
Jahr mehr Kinder, als jetzt in den ersten 10 Lebens- jahren
zusammengenommen. Es erlebten von 1000 Menschen: Kolb a. a. O. Da wir
den Betrag dieser nach Kolb im höchsten Grade wahrscheinlichen
Erleichterung der Lebensbedin- gungen auch nicht einmal annähernd
messen können, so ist jede Abschätzung der Vervollkommnung unserer Con-
stitution, die ihr Verhältniss zu den umgebenden äusseren Einwirkungen,
extralen wie socialen, benutzen will, aus- sichtslos. Dies gilt somit
auch für eine Verwerthung der That- sache, dass die Westarier seit dem
Alterthum so stark an Zahl zugenommen haben. Auch hier müsste erst eine
eventuelle Milderung der äusseren Einflüsse, besonders durch die im
Laufe der Generationen angehäuften Resultate der Culturarbeit, auf ihre
Grösse abgeschätzt werden, ehe man die starke Vermehrung auf eine
Steigerung der Consti- tutionskraft beziehen könnte. Es fragt sich, ob
wir auf einem anderen Wege zu einer leidlichen Beantwortung unserer
Frage kommen können, ob in den letzten ein bis zwei Jahrtausenden eine
Vervollkommnung der westarischen Rassen eingetreten ist. Wie wir früher
sahen, war das Organ, an dessen Ent- wickelung ganz überwiegend die
Vervollkommnung des menschlichen Typs geknüpft war, das Gehirn. Wenn
wir also die relativen Hirngewichte der Alten und der Moder- nen mit
einander vergleichen könnten, so würde uns das einen ungefähren
Rückschluss auf die eventuelle Vervoll- kommnung gestatten. Nun hatten
die Alten allerdings noch keine pathologischen Institute, wo sorgsam
die Hirn- gewichte registirt werden, allein ihre Schädel haben doch
recht häufig in stillen Gräbern bis auf unsere Tage aus- gehalten, so
dass wir wenigstens ihre Schädelinhalte oder -Capazitäten, die in
annähernd demselben Verhältniss zu einander stehen wie die
Hirngewichte, mit dem Inhalt moderner Schädel vergleichen können. Ehe
wir dazu übergehen, wollen wir einige Autoritäten auf dem Gebiete der
menschlichen Gehirnkunde darüber hören, ob es über- haupt gestattet
ist, Hirngrösse und Entwickelung des Geistes beim Menschen in eine
gewisse Parallele zu setzen, was natürlich nicht ausschliesst, dass die
Intelligenz auch noch von anderen Eigenschaften des Hirns als gerade
seiner Grösse abhängt. Theodor Bischoff spricht sich über diesen Punkt
folgendermassen aus: „Es ist im Allgemeinen eine unbe- streitbare
Thatsache der vergleichenden Anatomie und Psychologie, dass mit der
Entwickelung und Grösse der Gehirne der Thiere ihre Intelligenz steigt,
und dass der Mensch in beiden Hinsichten an der Spitze der Thierwelt
steht. Unzweifelhaft ist die psychologische Befähigung und Leistung des
Menschen an eine gewisse Grösse und Ent- wickelung des Hirns gebunden.
Unter einem gewissen Grade beider sehen wir, wie in Mikrocephalie
Blödsinn und Idiotismus auftritt. Erst wenn ferner das Gehirn seine
individuelle volle Ausbildung erlangt hat, entfalten sich die geistigen
Kräfte des Kindes..... Ein gewisser Grad des Hirnverlustes, auch wenn
es mit Erhaltung des Lebens möglich ist, bedingt dennoch Blödsinn und
mehr oder weniger grosse Störungen der psychischen Funktionen ..... Im
höheren Alter, wo die Geisteskräfte abnehmen und schwinden, verliert
auch das Gehirn an Masse und Gewicht. Umgekehrt hat man bei besonders
durch ihre Intelligenz und geistigen Eigenschaften hervorragenden
Persönlich- keiten oftmals besonders grosse und schwere Gehirne be-
obachtet, während man andererseits in der That nicht weiss, dass ein
psychisch ungewöhnlich begabter Mensch jemals ein ungewöhnlich kleines
Hirn besessen hat.“Vgl. Bischoff, Theodor. Das Hirngewicht des
Menschen. Bonn 1880. S. 134 und 135. Auch Welcker ist der Ansicht, dass
die geistig hoch- begabten Menschen Gehirne besitzen, deren Gewicht
fast immer und oftmals sehr erheblich über dem normalen Mittel der
betreffenden Altersstufe steht. Viele andere bedeutende Forscher haben
sich ähnlich geäussert. Würde sich also herausstellen, dass die Alten
weniger ge- räumige Hirnschädel hatten als das gegenwärtige Geschlecht,
so wären wir wohl berechtigt, daraus eine Steigerung der geistigen
Kräfte und damit der Erhaltungskraft gegen die Umgebung abzuleiten.
„Professor Broca hat gefunden, dass Schädel aus den Gräbern in Paris
vom 19. Jahrhundert gegen solche aus Gräbern des 12. Jahrhunderts in
dem Verhältniss von 1484: 1426 grösser waren, und dass die durch
Messungen er- mittelte Zunahme der Grösse ausschliesslich den
Stirntheil des Schädels betraf, — den Sitz der intellectuellen Fähig-
keiten. Auch Prichard ist überzeugt, dass die jetzigen Bewohner
Grossbritanniens viel geräumigere Hirnkapseln haben als die alten
Einwohner.“Darwin, Abstammung des Menschen. I. Bd. S. 70. Welcker fand
bei einer Serie von 20 Altrömern eine durchschnittliche
Schädelcapacität von 1406 ccm, bei einer anderen von 23 Altrömern eine
solche von 1387 ccm. Diesen Ziffern stehen Werthe von 1432—1460 ccm bei
modernen Italienern gegenüber. 12 Altgriechen wiesen einen Durchschnitt
von 1494, 10 Neugriechen von 1458 ccm auf; die Disserenz wird durch die
Mischung der Neugriechen mit slavischen Stämmen erklärt. Vier alte
Juden hatten einen Schädelinhalt von 1322, 20 moderne einen solchen von
1451 ccm. Diese von Welcker angegebenen Werthe beruhen wohl auf den
zuverlässigsten Messungen, die aus- geführt wurden.Welcker, H. Die
Capazität und die drei Hauptdurchmesser der Schädelkapsel bei den
verschiedenen Nationen. Arch. f. Anthropol. XVI. Bd. 1886, S. 1 und ff.
Eine Zunahme der Schädelcapazität von den Zeiten des Alterthums bis
heute wird also wahrscheinlich gemacht, jedoch sind diese Zahlen aus
verschiedenen Gründen, be- sonders auch wegen ihrer Kleinheit, nicht zu
einem sicheren Schluss verwendbar, sondern wir müssen, so lange nicht
bedeutend mehr Material zusammengetragen ist, bei dem Resultat bleiben,
zu dem Bischoff gekommen ist, dass nämlich ein Beweis für das Wachsthum
des Gehirns in geschichtlicher Zeit nicht erbracht ist, und dass die
dem Menschen ursprünglich zukommende Anlage so gross sein kann, dass
aller Fortschritt, den wir bis jetzt nachweisen können, sich allein
durch die Entwickelung dieser seiner Anlage erklären lässt und sich
wohl auch noch für lange Zeit sowohl in Beziehung auf die Individuen
als auf Ge- nerationen wird erklären lassen.Vgl. Bischoff, a. a. O. S.
169. Ebenso wenig wie der Weg, die mittlere Lebensdauer zu vergleichen,
ist also auch der Weg der Hirnvergleichung practikabel, so dass wir die
Frage, ob wir uns seit dem Alterthume vervollkommnet haben,
unentschieden lassen müssen. Die Untersuchung der zweiten Frage, ob wir
uns in der moderneren Zeit, also etwa in den letzten 50 oder 100
Jahren, in einer aufsteigenden oder niedergehenden Richtung in Bezug
auf die Vervollkommnung des Durch- schnittstyps der westarischen Rassen
befinden, können wir natürlich noch weniger durch objective Vergleiche
an Ge- hirnen und Schädeln entscheiden. Die Zeitunterschiede wären dazu
viel zu gering, und es ist auch nicht genügend Material vorhanden, um
die Frage befriedigend discutiren zu können. Ebenso wenig können wir
die Herabsetzung des Mini- malmaasses des Rekruten, die in manchen
Ländern, auch in Preussen, seit den ersten Jahrzehnten unseres Jahr-
hunderts thatsächlich stattgefunden hat, wirksam in die Er- örterung
ziehen. Denn erstens stehen dem andere That- sachen gegenüber, wie die
von Ammon für Baden und von Carette und Collignon für Theile
Frankreichs er- wiesene Erhöhung der Durchschnittsgrösse der
Rekruten,Vgl. Ammon, a. a. O. S. 120 u. f. die übrigens auf bessere
Ernährung zurückgeführt wird. Und zweitens können wir die Körpergrösse,
wenn die Ab- nahme nicht eine sehr starke ist, nicht in directe
Beziehung zur Constitutionskraft bringen, da, wie wir ja schon sahen,
hierbei das Hauptgewicht auf das Verhalten des Hirns zu legen ist, und
verschiedene andere Organe und ihre Corre- lationen ganz wohl von ihrer
früheren Höhe herabgehen können, ohne die Gesammtkraft der Constitution
zu ver- mindern. Nach der wahrscheinlichen Erleichterung der Lebens-
bedingungen jedoch zu urtheilen (vgl. S. 121), ist gemäss dem Princip
der Panmixie ein Rückgang der Con- stitution von dem früheren Grade
ihrer Vollkommenheit schon möglich — im Falle sich nämlich erworbene
Eigen- schaften, für uns die Uebungs- und Nichtübungs-Resultate der
Erziehung, nicht vererben. Fände eine solche Ver- erbung doch statt,
was ja in erheblichem Maasse allerdings unwahrscheinlich ist, dann wäre
eine Vervollkommnung trotzdem möglich, ja sogar sehr wahrscheinlich in
Anbe- tracht der gegen früher enorm viel grösseren Uebung aller
möglichen geistigen Functionen. Da wir ja nicht wissen, ob erworbene
Eigenschaften sich nicht doch vielleicht in einem gewissen Grade ver-
erben, so können wir eine befriedigende Deduction selbst bei der
Annahme der Gesammtmilderung der Lebens- bedingungen nicht vornehmen.
Für eine exacte Entscheidung der Frage sind somit keine genügenden
Grundlagen vorhanden. Wir müssen auch diese Frage in suspenso lassen,
wollen jedoch nicht verhehlen, dass wir zum Glauben an eine leichte
Entartung geneigt sind, besonders bei Völkern wie den Franzosen, die
durch Verminderung ihrer Geburtenrate den Socialkampf zu sehr
abgestumpft haben. Des Interesses halber sollen einige prägnante Äusse-
rungen hervorragender Männer über diesen Gegenstand hier Platz finden.
Wallace berichtet über des alten Darwin MeinungWallace. Menschliche
Auslese. Zukunft v. Harden. Berlin. 7. Juli 1894. S. 10.: „In einer
meiner letzten Unterhaltungen mit Darwin sprach er sich sehr wenig
hoffnungsvoll über die Zukunft der Menschheit aus, und zwar auf Grund
der Beobachtung, dass in unserer modernen Civilisation eine natürliche
Auslese nicht zu Stande komme und die Tüch- tigsten nicht überlebten.
Die Sieger im Kampf um das Geld sind keineswegs die Besten oder die
Klügsten, und bekanntlich erneuert sich unsere Bevölkerung in jeder
Generation in stärkerem Maasse aus den unteren als aus den mittleren
und oberen Klassen.“ Wallace citirt dann weiter den Amerikaner Hiram M.
Stanley: „Wir haben vor uns das traurige Schauspiel, dass sich die
grosse Masse der Gesellschaft aus den untersten Klassen rekrutirt, da
die obersten Klassen zum grossen Theil entweder gar nicht heirathen
oder doch keine Kinder haben. Die grosse Mehrheit der Bevölkerung sind
immer die Minderwerthigen, und doch ersetzt sich der Strom des Lebens
in ausge- dehntem Maasse aus dieser Quelle. Eine solche Sachlage ist
für jede Gesellschaft mit grosser Gefahr verbunden, in der
demokratischen Civilisation unserer Tage aber bedeutet sie einfach
ihren Selbstmord.“ Wallace selbst hat mehr Zuversicht in unsere Zeit:
„… es scheint, dass im Ganzen ein entschiedener Gewinn erzielt worden
ist. Gesundheit, Ausdauer, Selbstzucht und Verstand sind im Zunehmen
begriffen in Folge des langsamen Ausjätens der Unge- sunden, Müssigen,
der gröblich Lasterhaften, der Grau- samen, der Geistesschwachen, und
es mag wohl theilweise auf Rechnung der grösseren Zahl der höheren und
mittleren Naturen, die so entstanden sind, zu setzen sein, dass wir von
einem zweifellosen Wachsen der Menschlichkeit, der Theilnahme mit den
Leiden von Menschen und Thieren, sprechen können, das vielleicht das
bezeichnendste und erfreulichste Merkmal unserer Tage ist.“Wallace,
Menschheitsfortschritt. Zukunft von Harden. Berlin. 28. Juli 1894. S.
148. 9 Die besten Rassen. Zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die
haupt- sächlichsten Rassen in Bezug auf den gegenwärtigen Unter- schied
ihres Culturwerthes; wir wollen damit zu recht- fertigen suchen,
weshalb wir im Capitel über die Zahl nur Westarier und Juden
berücksichtigt und ihr Interesse mit dem der menschlichen Rasse
überhaupt identifizirt haben. Wir müssen auch hier wiederholen, dass
die heutigen Völker, wie die heutigen Angehörigen einer Muttersprache,
starke Rassengemische sind, die durch mehr oder minder langes
Zusammenwohnen und dementsprechende Kreuzung der einzelnen
Bestandtheile, sowie durch das verschiedene Verhalten derselben im
Kampf um’s Dasein mehr oder minder stark zusammengeschweisst sind, so
dass man mit sehr verschiedener Berechtigung von neuen Rassen sprechen
kann. Man kann z. B. eher von einer englischen, deutschen und
französischen Rasse reden, als von einer ungarischen oder
nordamerikanischen. Trotzdem haben viele Gemische im Lauf der
Jahrhunderte ein charakteristisches Gepräge er- halten, so dass es um
so mehr berechtigt ist, sie zu ver- gleichen, als nach der Meinung der
meisten Anthropologen auch die Urrassen, aus denen sie entstanden,
ihrerseits wieder aus noch älteren Rassen zusammengesetzt waren.
Westarier. Die Westarier machen zu 93 % die Bevölkerung Europas aus. In
den Urbevölkerungen der anderen Erd- theile sind sie nicht nennenswerth
vertreten. Deshalb sind folgende Angaben von Barnard Davis im vollen
Einklang mit ihrer ohne Weiteres in die Augen springenden Stellung an
der Spitze der Culturbewegung. Davis hat durch sorgfältige Messungen
nachgewiesen, dass die mittlere Schädelcapazität bei Europäern 1509,2
ccm, bei Ameri- kanern (Indianern) 1458,4, bei Asiaten 1453,5, bei
Afrika- nern 1412,6 und bei Australiern nur 1338,8 beträgt.Citirt in
Oskar Peschel, Völkerkunde. Leipzig 1885. S. 66. — Vgl. auch S. 132 u.
133. Es ist männiglich bekannt, dass die Westarier die thatsächlichen
Beherrscher fast der ganzen Erde sind, und dass das Gebiet, in dem ihr
Einfluss heute noch nicht dominirt, sich rasch verkleinert. Europa ist
ihr Heimatsitz. Nordamerika wird fast völlig von den Germanen
beherrscht, Südamerika von den Romanen. Australien, Neu-Seeland und
Ozeanien werden ebenfalls fast völlig von den Ger- manen eingenommen.
In Afrika theilen sich die einzelnen westarischen Zweige in die
Herrschaft; die wirklich unab- hängigen Gebiete sind nur noch sehr
klein. Asien ist der einzige Theil der Erde, in dem die Westarier nicht
so aus- schliesslichen Einfluss ausüben. Hier bilden noch die Mongolen
compacte unabhängige Gemeinwesen in China, Japan und in der Türkei,
auch einige ostarische Stämme haben sich unabhängig erhalten, wie die
Perser z. B., allein auch in diese Inseln fressen die Wogen der
europäischen Macht immer grössere Lücken. Die Westarier documentiren
sich dadurch so deutlich als die hervorragendste Culturrasse unserer
Zeit, dass man darüber keine Worte weiter zu verlieren braucht.
Interessant ist nur, wie demgegenüber die Ostarier in ihrer Entwicke-
lung zurückgeblieben sind. Trotzdem sie in Massen von Hunderten von
Millionen den südlichen Theil des asiatischen Continents einnehmen,
haben sie es zu einer solchen Cultur- rolle wie die Westarier auch
nicht im entferntesten ge- bracht, wohl hauptsächlich wegen ihres
Wohnens in er- schlaffenden tropischen und subtropischen Gegenden. Ihr
Zurückbleiben zeigt sich denn auch an dem Substrat ihrer geistigen
Fähigkeiten, dem Gehirn, bezw. dem Gehäuse, in dem es liegt. Welcker
fand bei 68 Hindus Schädel- 9* capazitäten von nur 1260—1370 ccm, gegen
1400—1550 ccm bei den Westariern. Dies sind Unterschiede, die, wenn sie
sich auch bei grösseren Zahlen von Individuen be- stätigen würden,
selbst bei Berücksichtigung der kleineren Statur der Hindus schwer in’s
Gewicht fallen. Interessant würde ferner noch sein, zwischen den ein-
zelnen westarischen Rassen selbst eine Rangordnung in Be- zug auf ihre
mehr oder minder grosse Vollkommenheit zu construiren. Unterschiede
sind ja sicher vorhanden, jedoch ist es aus Mangel an genügendem
Material so schwer, sie festzustellen, dass man sich auf Vermuthungen
be- schränken muss. Was das mittlere Hirngewicht anlangt, so liefern
die bisherigen Untersuchungen ein viel zu kleines Material und ziehen
nicht exact genug die Körpergrösse der betreffen- den Individuen in
Betracht. Daraus allein Schlüsse zu ziehen, wäre vorschnell.
Ebensowenig brauchbare That- sachenreihen existiren für das relative
Massenverhältniss des Stirnhirns zum Gesammthirn. Die folgenden
Zahlenangaben beanspruchen deshalb nur Interesse, aber keine Be-
weiskraft. Die mittlere Schädelcapazität betrug nach WelckerWelcker, a.
a. O. bei ccm Deutschen 1478 Holländern 1414—1485 Skandinaviern
1426—1440 Schweizern 1427—1543 Engländern 1531 allen Germanen 1480
Kelten 1450—1503 Franzosen 1498 Italienern 1432—1460 ccm Spaniern 1472
Portugiesen 1467 Neugriechen 1458 Rumänen 1408 Slaven 1479 Juden 1451
Arabern 1476 Finnen 1464 Magyaren 1440 ccm Türken 1452 Japanern (8)
1385 Chinesen 1444 Malaien 1402 Negern 1320—1336 Buschmännern 1240
Indianern 1440 ccm Schwankungsbreite bei den Germanen 1400—1550 Slaven
1400—1550 Kelten, Romanen und Griechen 1400—1500 Mongolen 1320—1490
Alle obigen Zahlen sind nur aus verhältnissmässig wenigen Messungen
gewonnen, einzig bei den Deutschen beliefen sich letztere etwas höher,
auf 245. Unter den Deutschen wiesen Altbayern und eine Abtheilung der
Schweizer die höchsten Werthe aller Germanen auf (1540 u. 1543 ccm).
Betrachten wir die allgemeine culturelle Höhe, die die einzelnen Zweige
der Westarier erklommen haben, so er- geben sich ziemlich bedeutende
Unterschiede zu Gunsten des germanischen Zweiges. Die Skandinavier,
Engländer, Deutschen und weissen Nordamerikaner stehen entschieden
obenan. Das ist nicht nur der Fall beim Vergleich der einfachsten
Elemente der Volksbildung (Analphabeten sind bei ihnen nur wenige
Procente, dagegen in Italien etwa 50, in Russland etwa 75 % der
Bevölkerung), sondern auch mit der Tüchtigkeit ihrer Staatsverwaltung
und der Ver- breitung von künstlerischer und wissenschaftlicher Cultur
unter dem Volk, das hierbei in den romanischen und slavischen Ländern
ja schon durch die mangelhafte Fähigkeit zu lesen und zu schreiben
erheblich beeinträch- tigt ist. Wie auffallend gross diese Unterschiede
sind, möge die folgende Zusammenstellung zeigen.Vgl. A, Jacobi, Zur
Analphabeten-Statistik. Neue Zeit. XIII. Jahrg. 1. Bd. Stuttgart
1894—95. S. 658. Um 1881 war der Procentsatz der männlichen
Analphabeten in Die Tabelle spricht für sich selbst. Es ist hier nicht
der Ort, diese Verhältnisse noch aus- führlicher darzulegen. Ich will
nur noch kurz hinweisen auf das Aufblühen der germanischen Cultur in
Europa, während die Romanen und Slaven erheblich zurückgeblieben sind.
Die keltischen Völker stehen beträchtlich besser da. Unter ihnen nehmen
die Franzosen, ein Mischvolk, dessen nördlicher, stark mit Germanen
versetzter Theil übrigens der culturkräftigste gewesen ist, einen
besonders günstigen Platz ein, sind aber doch, was Breite der
Volksbildung anlangt, gegenüber den germanischen Ländern etwas im
Hintertreffen, unbeschadet ihrer glänzenden Vertreter von Wissenschaft
und Kunst. In Amerika verhält es sich ähnlich. Der Norden, Canada und
die Vereinigten Staaten stehen in cultureller Beziehung bergehoch über
Mexico und sämmtliche südamerikanischen Staaten, in denen das
romanische Element das tonangebende ist. Hier, auf dem fremden Boden,
wo beide Rassen Gelegenheit hatten zu zeigen, was sie leisten können,
haben die Germanen einen glänzenden Aufschwung genommen, während die
Romanen mühsam über Revolutionen und wieder Revolutionen hinter- drein
stolpern. Der Anthropologe Lombroso hält das englische Volk für das am
höchsten entwickelte in Europa.Lombroso, C. Der Antisemitismus und die
Juden. Deutsch von Kurella. Leipzig. 1894. Auch Darwin scheint die
Angelsachsen für die tüchtigste Rasse der Erde zu halten. Er sagt in
seiner Abstammung des Menschen hierüber: „Der merkwürdige Erfolg der
Engländer als Colonisten gegenüber anderen europäischen Nationen,
welcher durch einen Vergleich der Fortschritte der Canadier englischen
und französischen Ursprungs er- läutert wird, ist deren unerschrockenen
und ausdauernden Energie zugeschrieben worden; wer kann aber sagen, wie
die Engländer ihre Energie erlangten? Wie es scheint, liegt in der
Annahme sehr viel Wahres, dass der wunder- bare Fortschritt der
Vereinigten Staaten ebenso wie der Charakter des Volks die Resultate
natürlicher Zuchtwahl sind. Die energischeren, rastloseren und
muthigeren Menschen aus allen Theilen Europas sind während der letzten
zehn oder zwölf Generationen in jenes grosse Land eingewandert und
haben dort den grössten Erfolg gehabt. Blicken wir auf die weiteste
Zukunft, so glaube ich nicht, dass die Ansicht des Mr. Zincke
übertrieben ist, wenn er sagt: „„Alle Reihen von Begebenheiten — z. B.
die, welche als Resultat die geistige Cultur in Griechenland, und die;
welche die römische Kaiserzeit hervorgehen liessen — scheinen nur Zweck
und Bedeutung zu erhalten, wenn sie im Zu- sammenhang mit, oder noch
eher als Unterstützung für … den grossen Strom angelsächsischer
Auswanderung nach dem Westen hin betrachtet werden.““ So dunkel das
Problem des Fortschritts der Civilisation ist, so können wir wenigstens
sehen, dass eine Nation, welche eine lange Zeit hindurch die grösste
Zahl hoch intellectueller, ener- gischer, tapferer, patriotischer und
wohlwollender Männer erzeugte, im Allgemeinen über weniger begünstigte
Nationen das Übergewicht erlangen wird“. So weit Darwin, der
Angelsachse. Erinnern wir uns noch aus dem Capitel über die Vermehrung
der Zahl, dass von allen Westariern die Angelsachsen sich am stärksten
ausbreiten, und dass auch die englische Sprache die übrigen
westarischen Sprachen in ihrer Entwickelung weit hinter sich lässt, so
scheint das Darwin’s Ansicht nur zu bestätigen. Doch diese höhere
Entwickelung des germanischen Zweiges der Westarier darf uns noch nicht
ohne Weiteres dazu veranlassen, ihre Anlagen für höher zu erklären.
Materielle, klimatische und sonstige, theilweise als Zufall
erscheinende Verhältnisse konnten schon in längst ver- gangener Zeit
für das eine oder das andere Volk einen Fortschritt bedingt haben, der,
einmal gegeben, in seinem Gefolge immer neue Fortschritte für die
Begünstigsten nach sich zog. Deshalb muss die Frage der Rangordnung der
westarischen Rassen vorläufig offen bleiben. Im Grossen und Ganzen ist
die romanische Rasse dem dem wärmeren Klima besser angepasst, die
germanische mehr dem kälteren. Die Romanen leiden unter kälteren
Klimaten sehr durch Lungenkrankheiten und Schwindsucht, die Germanen
können ebensowenig in warmen Klimaten die Romanen dauernd verdrängen
(Aufsaugung der blonden Ele- mente in Südeuropa), so dass wir an ein
dauerndes Eindringen germanischer Rassen in die meisten der romanischen
Wohngebiete nicht denken können. Aber selbst, wenn dieses möglich wäre,
würde der Einfluss des wärmeren Klimas höchst wahrscheinlich doch die
Tüchtigkeit der Söhne des Nordens wieder von ihrer Höhe herabdrücken,
da es eine weit verbreitete Erscheinung auf der Erde ist, dass,
abgesehen von der kalten Zone, im Grossen und Ganzen innerhalb einer
grossen Rasse die Stämme kälterer Klimate die wärmerer in der
Entwickelung von Thatkraft und Intelligenz überragen. Auch die Römer
und Griechen des Alterthums waren von Norden her in Italien und
Griechenland eingewandert. Die schärfere Auslese in dem ungünstigeren,
rauhen Klima scheint in der darin wohnenden Rasse eine Stei- gerung der
Körper- und Geisteskräfte zu bedingen. Die allmählige Emancipation des
Menschen von den directen Natureinflüssen lässt hoffen, dass auch die
Rassen warmer Gegenden dauernd in den Stand gesetzt werden, ihre
angeborenen Anlagen voll zur Enfaltung zu bringen und sie zu steigern.
Juden. Zum Schluss wollen wir noch einigen Bemerkungen über die
jüdische Rasse Raum geben. Wir haben früher die Juden neben den
Westariern als höchstentwickelte Culturrasse angeführt. Angesichts der
neuerdings wieder erstarkten antisemitischen Strömung ist es nöthig,
dies kurz zu rechtfertigen. Es ist soviel über den Gegenstand ge-
schrieben worden,Vgl. Alsberg. Rassenmischung im Judenthum. Vorträge
von Virchow und Holtzendorff. Neue Folge. 5. Serie. Heft 116. Hamburg
1891. — Gerecke, A. Die Verdienste der Juden um die Erhaltung und
Ausbreitung der Wissenschaften. Zürich 1893. — Jacobs, J. The Jews.
Journal of the Anthropological Institute of Great Britain. London
1885/86 u. 1891. — Leroy-Beaulieu, A. Les Juifs et l’Antisémitisme.
Paris 1893. Auch deutsch von Vin- centi. Wien 1893. — Lombroso, C. Der
Antisemitismus und die dass ich nur hervorheben will, was ihre Stellung
als Rasse charakterisirt. Die europäischen Juden, die, wie wir sahen,
sich in den letzten Jahren stärker als irgend eine andere Rasse in
Europa vermehrt haben, sind weder jetzt eine einheitliche Rasse, noch
haben sie einen starken Abstam- mungs-Zusammenhang mit den Juden der
ältesten Zeiten. Lombroso sagt hierüber: „Die Theorie der Rassen-
kreuzung im Judenthum erklärt, dass der blondhaarige jüdische Typus in
Südeuropa so selten, in Nordeuropa so häufig, bis zu 29 %, vorkommt,
und dass der englische Jude oft das glatte, feine, blonde Haar, das
blaue Auge und die hohe Stirn besitzt, die den echten Angelsachsen
auszeichnet. Aus demselben Grunde haben die Juden in Piemont vor-
wiegend Rundköpfe und Blondhaare, in Venetien vier- eckigen länglichen
Schädel und schwarzes Haar, deshalb haben die Juden der Oase Uaregh die
Haut der Neger und die Gesichtsform der Weissen, und die Abessiniens
die Plattnase, die dicken Lippen, die Prognathie (vor- stehenden
Kiefer) und selbst das Wollhaar der Afrikaner und zugleich die helle
Haut der Europäer. Es hat eben überall die ursprünglich jüdische Rasse
den Einfluss der Rassenkreuzung und des Klimawechsels erfahren.“ Die
Rassenkreuzung ist so stark gewesen, dass Lom- broso den Bruchtheil der
Juden mit rein semitischem Blut mit Sicherheit nur auf etwa 5 % angeben
kann.Diesen Mindest-Gehalt an reinem semitischen Blut folgert Lombroso,
etwas zu einseitig auf die Craniologie fussend, aus den 5 % Langschädel
unter den Juden. Die echten Semiten gelten als langschädelig. Luschan,
auf den er sich neben Leroy-Beaulieu und Jacobs hauptsächlich stützt,
betrachtet nur noch die Beduinen Süd- arabiens als rein semitisch. Ihre
Rassenmerkmale sind die längliche Schädelform, die dunkle Pigmentirung
und Juden im Lichte der modernen Wissenschaft. Deutsch von Kurella.
Leipzig 1894. — Luschan. Die anthropologische Stellung der Juden.
Berlin 1892. eine kurze kleine Nase. Luschan dagegen fand bei 60000
Juden 50 % Kurzschädel und bei 11 % blondes Haar, eigentliche
Langschädel waren nur 5 %. Die reine semitische Nase, nicht was wir
gewöhnlich jüdische Nase nennen, war ebenfalls nur wenig vertreten.
Jacobs unter- suchte in England 120 000 Juden und fand bei 21 % blaue
Augen und bei 29 % blonde Haare. Im deutschen Reich (ausser Hamburg)
hatten 1875 unter den Schulkindern Nach Alsberg hat schon vor
Jahrtausenden in Palästina und Vorderasien eine intensive Vermischung
des jüdischen Stammes mit einem indogermanischen Volke und wahr-
scheinlich auch mit Angehörigen der mongolischen Rasse stattgefunden.
Bei der Einwanderung der Israeliten in Palästina sei ein Theil dieses
Landes von einer durch hellen Teint, röthliches Haar und blaue Augen
gekennzeichneten Rasse bewohnt gewesen. Die Mischung mit hellenischen
Elementen durch Ankauf griechischer Sclaven und Sclavinnen ist
sichergestellt. Lombroso zieht zur Erklärung auch noch Vermischungen
mit den Kreuzfahrern und später überall mit der Bevölkerung, in der die
Juden lebten, heran. Er kommt in seinen Ausführungen zu folgendem
Schluss: „Der ganze angebliche Rassengegensatz verflüchtigt sich also
im Lichte der craniologischen Forschung, die uns zeigt, dass im
Judenthum mehr arisches als semitisches Blut steckt. Die breite arische
Grundlage des Judenthums empfing die fruchtbare Anregung der
Rassenkreuzung, die, wie wir sehen werden, ein wesentlicher Factor des
mensch- lichen Fortschritts ist, und zusammen mit der noch mäch- tiger
anregend wirkenden klimatischen Anpassung uns er- klärt, wie das
Judenthum, trotz mancher auf Inferiorität hin- wirkenden Eigenschaften
(und hierher gehört auch der mindestens 5 % betragende Gehalt derselben
an semitischem Blute), sich so ganz arischen Gewohnheiten angepasst
.... hat und der arischen Bevölkerung, unter der sie leben, in so hohem
Grade ähnlich geworden sind; bei alledem muss man einräumen, dass sie
einen eigenthümlichen Typus be- wahren, der bei der Inzucht unter den
Juden und ihrer abgeschlossenen, wenig differenzirten Lebensweise mit
Noth- wendigkeit entstehen musste.“ Die Juden scheinen also mehr Arier
als Nichtarier zu sein. Das bringt sie natürlich den westarischen
Cultur- rassen schon ganz bedeutend näher. Die Entfernung ver- ringert
sich noch mehr, wenn man in Betracht zieht, wo- rauf Leroy-Beaulieu
hingewiesen hat, dass auch die Europäer durchaus keine reinen Arier
sind. Die alten Ur- einwohner, die Europa vor der arischen Einwanderung
be- setzt hielten, sind zum grossen Theil mit den Ariern zu-
sammengeschmolzen, so dass ein gewisser Procentsatz nichtarischen
Blutes mehr oder weniger den Europäern beigemischt ist. „So mancher
Franzose und Deutsche, der sich von reinster indogermanischer Abkunft
glaubt, ist ein Nachkomme der Höhlenmenschen.“ Zu der Thatsache der
Rassenmischung kommt noch hinzu die Wirkung der natürlichen Zuchtwahl.
Die Juden sind im Allgemeinen denselben Extralbedingungen unter-
worfen, wie die Menschen, unter denen sie leben. Sie variiren in vielen
Eigenschaften ganz ähnlich wie sie. Wenn nun die natürliche Zuchtwahl
bestimmte dieser Variationen immer wieder auslas und häufte, so mussten
verschiedene Charaktere, nämlich alle die von Extralbedingungen ab-
hängigen und ihre Correlationen, sich gerade so bei den Juden wie bei
den Nicht-Juden gestalten. Dies hat sicher neben der geschlechtlichen
Mischung viel dazu beigetragen, den Typus der Juden dem der Völker
ähnlich zu machen, unter denen sie leben. Daher mag z. B. ein Theil der
blauen Augen und blonden Haare der Juden des nördlichen Europas
herrühren. Man kann sich bei Betrachtung des intellectuellen und
Charakter-Unterschiedes der Nord- und Südeuropäer nicht des Gedankens
erwehren, dass auch ein grosser Theil ihrer geistigen
Eigenthümlichkeiten mit den klimatischen Wirkungen zusammenhängt, so
dass auch die geistige Verwandtschaft der Juden mit ihrem Wohn-Volk
theilweise auf dem Wege klimatischer Anpassung in dar- winistischem
Sinne direct oder als Correlationen erworben zu sein scheint. Die hohe
geistige Befähigung der Juden und ihre her- vorragende Rolle in dem
Entwickelungsprocess der Mensch- heit muss angesichts der Namen Jesus,
Spinoza, Marx ohne Weiteres mit Freuden anerkannt werden. Zu Zeiten,
wie nach dem Niedergang der byzantinischen Cultur, waren die Juden und
andere Semiten, die Araber, fast die alleinigen Träger und Hüter der
Wissenschaft, besonders der Naturwissen- schaft und der Medizin, und
haben dabei, oft unter Er- duldung von Verfolgungen, Dienste geleistet,
die ihnen kein Bürger der Republik der Wissenschaften je vergessen
wird. An die zahlreichen Juden der Jetztzeit, die auf den Ge- bieten
der Wissenschaft, der Kunst und des öffentlichen Lebens Hervorragendes
leisten, braucht nur erinnert zu werden. Alle die Beziehungen der Juden
zu den Mitbewohnern und den natürlichen Bedingungen ihres Wohnortes
lassen es nicht zu, dass eine künstliche Scheidewand zwischen ihnen und
den Westariern aufgerichtet werde, sondern sie müssen als gleich hoch
stehende Culturrasse angesehen und behandelt werden, deren völlige
Aufsaugung nicht nur im bürgerlichen Interesse liegt, sondern auch für
die Ver- edelung beider Theile, Juden wie Nichtjuden, von grossem
Vortheil sein kann. Vermischung ähnlicher Rassen wird von fast allen
Biologen als ein Mittel der Steigerung der Rassentüchtigkeit und als
Quelle guter Variationen aner- kannt (Japaner aus Mongolen und
Malaien). Der ganze Antisemitismus ist ein Schlag in’s Wasser, dessen
Wellen- kreise in der Fluth der naturwissenschaftlichen Erkenntniss und
der humanen Demokratie langsam vergehen werden, und zwar um so eher, je
weniger der reactionär-nationale Wind hineinblasen wird, der sich
neuerdings unter den Juden erhoben hat. Es giebt zweifellos noch andere
kleine Rassen mit hohen Culturanlagen, wie z. B. die Magyaren, doch
würde eine eingehendere Beschäftigung mit ihnen sich nicht mit der
Oekonomie unserer Arbeit vertragen. 4. Capitel. Der ideale und der
heutige Rassenprocess. Der ideale Rassenprocess. Erzeugung guter
Devarianten, natür- liche und künstliche Zuchtwahl. — Der heutige
Rassenprocess. Variation. Erzeugung schlechter Devarianten durch
mangelhafte sexuelle Zuchtwahl, Jugendlichkeit der Eltern, giftige
Genussmittel. Auslese. Künstliche Ernährung von Säuglingen. Ungleiche
Erziehung. Wirth- schaftliche Ausjätung. Armuth ist selectorisch und
nonselectorisch. Wirkungen der Armuth und des Wohlstands auf
Gesundheits- zustand. Ehe- und Geburtenziffer. Ersetzt sich die
Bevölkerung mehr aus den Armen oder aus den Wohlhabenden?
Contraselection, grosse Städte. Nonselectorische Schädlichkeiten,
Unfälle, Trinksitten — Kurze Gegenüberstellung der beiden Processe. Der
ideale Rassenprocess. Unter Rassenprocess wollen wir die Gesammtheit
der Vorgänge im Lebensprocess einer Rasse in Bezug auf Variation, Kampf
um’s Dasein und Vererbung zusammen- fassen. Nach unseren früheren
Ausführungen wird es uns interessiren, die aufgestellten
rassenhygienischen Forde- rungen zur möglichst raschen Vermehrung und
Vervoll- kommnung einer Rasse einmal etwas mehr zu zergliedern und zu
sehen, welch’ ein Bild etwa eine Gesellschaft in groben Zügen darbieten
würde, wenn sie ausschliesslich danach eingerichtet wäre. Es handelt
sich also um die Grundlinien einer Art rassenhygienischer Utopie, über
deren komisches und grausames Äussere der Leser nicht zu er- schrecken
braucht, es ist ja eben nur eine Utopie von einem einseitigen, durchaus
nicht allein berechtigten Standpunkt aus, welcher nur den Conflict der
bis in ihre Consequenzen verfolgten Anschauungen gewisser
darwinistischer Kreise mit unseren Culturidealen deutlich hervortreten
lassen soll. Verfolgen wir ein junges Ehepaar, dem die Fort- pflanzung
auf Grund ihrer Qualitäten, wie wir nachher noch sehen werden, erlaubt
war, in seinen weiteren Schicksalen. Die Lebensführung der Gatten ist
beherrscht von der Rücksicht auf die Erzeugung guter Kinder, sie suchen
nach gesunder Wohnung, zuträglicher Nahrung, vermeiden die Einfuhr von
allerlei Giften, wie Alkohol und Tabak, be- wegen sich viel in frischer
Luft und leben überhaupt ihrem Elternberuf schon lange vor der Zeugung.
Diese selbst wird nicht irgend einem Zufall, einer angeheiterten Stunde
überlassen, sondern geregelt nach den Grundsätzen, die die Wissenschaft
für Zeit und sonstige Bedingungen auf- gestellt hat. Die zur
Durchführung nothwendigen Kennt- nisse und Mittel der Praeventiv-Praxis
werden durch die Gesellschaft Allen vermittelt und zugänglich gemacht.
Nach Beginn der Schwangerschaft wird die junge Mutter als eine höchst
wichtige Persönlichkeit betrachtet, man gewährt ihr alle möglichen
Mittel für ihr eigenes und das Gedeihen ihrer Leibesfrucht, sowie für
den ungestörten Ablauf der normalen Geburt. Stellt es sich trotzdem
her- aus, dass das Neugeborene ein schwächliches oder miss- gestaltetes
Kind ist, so wird ihm von dem Aezte-Collegium, das über den Bürgerbrief
der Gesellschaft entscheidet, ein sanfter Tod bereitet, sagen wir durch
eine kleine Dose Morphium. Die Eltern, erzogen in strenger Achtung vor
dem Wohl der Rasse, überlassen sich nicht lange rebellischen Gefühlen,
sondern versuchen frisch und fröhlich ein zweites Mal, wenn ihnen dies
nach ihrem Zeugniss über Fort- pflanzungsbefähigung erlaubt ist. Dieses
Ausmerzen der Neugeborenen würde bei Zwil- lingen so gut wie immer und
principiell bei allen Kindern vollzogen werden, die nach der sechsten
Geburt oder nach dem 45. Jahr der Mutter, bezw. dem 50. Jahr des Vaters
überhaupt noch — entgegen einem gesetzlichen Verbot — geboren werden.
Die im ersten Examen bestandenen Kinder werden nun gesäugt. Ammen zu
halten, ist nur beim Tode des Ammen- kindes gestattet und nur, wenn die
Mutter durch über- mächtige Einflüsse an dem eigenen Stillen verhindert
ist. Anpreisung und Verkauf von künstlichen Kindernährmitteln ist
verboten. Vor allen directen grossen Schädlichkeiten werden im Übrigen
die Kinder sorgsam bewahrt. Im ganzen Verlauf der späteren Erziehung
werden alle Körperfunctionen, besonders aber die des Gehirns, maximal
geübt. Nach Beendigung der Erziehung, zu deren vorzüg- lichsten Zwecken
es auch gehört, einen starken Sinn für Rassenwohl zu erwecken, wird
eine Prüfung der einzelnen Jünglinge und Mädchen vorgenommen, die sich
besonders auch auf die intellectuellen und moralischen Qualitäten be-
zieht, und die nach einer Methode vorgenommen wird, die wenigstens
theilweise eine weitere Ausbildung der von KraepelinKraepelin, E. Ueber
geistige Arbeit. Jena 1894, und Ueber die Beeinflussung einfacher
psychischer Vorgänge durch einige Arzneimittel. Jena 1892. empfohlenen
repräsentirt. Die Censuren in dieser Prüfung lauten nicht bloss gut,
genügend, unge- nügend etc., sondern auch noch: darf keine, eines,
zwei, drei oder mehr Kinder zeugen in der Ehe, die eventuell
eingegangen wird. Während der Ehe, welche ganz schwächlichen oder
defecten Individuen nicht gestattet ist, regulirt sich die Zahl der
Kinder, die man dem Paare erlaubt, nach dem Durchschnitt der beiden
Zahlen, die jedem der Eltern er- laubt waren, wobei dem Durchschnitt ja
stets ½ zugefügt werden könnte, im Fall sich keine ganze Zahl ergiebt.
10 Niemandem ist vor der vollen sexuellen Ausreifung — beim Manne wohl
nicht vor Vollendung des 26., beim Weibe des 24. Jahres — das Ausüben
der Fortpflanzungs- Functionen gestattet. Zum Zweck einer weitgehenden
Möglichkeit guter sexueller Zuchtwahl ist dafür Sorge getragen, dass
junge Männer und Frauen in der ausgiebigsten Weise mit ein- ander in
gesellschaftliche Berührung kommen, auch in ge- meinsamen Seebädern,
dass also jedes Individuum des einen Geschlechts Gelegenheit hat,
möglichst viele Individuen des andern Geschlechts körperlich und
geistig kennen zu lernen und eine möglichst passende Wahl zu treffen.
In Bezug auf die Bewerbung um ökonomische Nähr- stellen sind folgende
Einrichtungen vorhanden, bezw. nicht vorhanden: Erbrecht — ausgenommen
für Andenken und Consum- güter — existirt nicht, da die Möglichkeit
vorliegt, dass im wirthschaftlichen Wettkampf vortreffliche Eltern in
ihren Nachkommen entarten und diese nun durch ererbtes Ver- mögen einen
Schutz geniessen würden. Jedes Individuum betritt den ökonomischen
Kampfplatz mit keiner anderen ungleichen Ausrüstung als seinen
Fähigkeiten, im übrigen wird Jedem ein gleicher Antheil an den
gesellschaftlichen Productionsmitteln gewährt. Dies ist möglich in der
Form eines Credits in gewisser Höhe, mit dem dann der Einzelne für sich
muss wirthschaften oder sich an grösseren Unternehmungen muss
betheiligen können, ohne durch irgend welche Privilegien von Classen
oder Ständen an der Entfaltung seiner Fähigkeiten gehemmt zu werden.
Unter solchen Umständen würde wohl manches Söhnchen reicher oder
privilegirter Eltern einen schweren Stand haben. Wer sich dann in dem
ökonomischen Kampf als schwach erweist und sich nicht erhalten kann,
verfällt der Armuth mit ihren ausjätenden Schrecken. Armen-Unter-
stützung darf nur minimal sein und nur an Leute verab- folgt werden,
die keinen Einfluss mehr auf die Brutpflege haben. Solche und andere
„humane Gefühlsduseleien“ wie Pflege der Kranken, der Blinden,
Taubstummen, überhaupt aller Schwachen, hindern oder verzögern nur die
Wirksam- keit der natürlichen Zuchtwahl. Besonders für Dinge wie
Krankheits- und Arbeitslosen- Versicherung, wie die Hülfe des Arztes,
hauptsächlich des Geburtshelfers, wird der strenge Rassenhygieniker nur
ein missbilligendes Achselzucken haben. Der Kampf um’s Dasein muss in
seiner vollen Schärfe erhalten bleiben, wenn wir uns rasch
vervollkommnen sollen, das bleibt sein Dictum. Gegen blutige
Revolutionen, besonders solche, in denen das Princip der
Gleichberechtigung der Schwachen Zeugniss seiner unwiderstehlich
wachsenden Kraft ablegt, wird er auf’s heftigste eifern, als gegen eine
unnöthige Zerstörung guter Individuen. Gegen die Kriege wird er weniger
etwas haben, da sie eines der Mittel im Kampf um’s Dasein der Völker
bilden. Nur wird er darauf dringen, dass entweder mit Söldnerheeren
gekämpft wird, oder dass die Aushebung beim System der allgemeinen
Wehrpflicht so umfassend wie nur möglich ist, um recht viele auch der
schlechteren Individuen in’s Heer zu bekommen, so dass der Nachtheil
für die guten Convarianten nicht zu stark wird. Während des Feldzugs
wäre es dann gut, die besonders zusammen- gereihten schlechten
Varianten an die Stellen zu bringen, wo man hauptsächlich Kanonenfutter
braucht, und wo es auf die individuelle Tüchtigkeit nicht so ankommt.
Bei solchem oder ähnlichem Gewährenlassen der natür- lichen Zuchtwahl,
die in unserem Beispiel noch durch eine künstliche verstärkt ist, wäre
eine rasche Vervollkommnung der Rasse zu erwarten. 10* Der heutige
Rassenprocess. Gegenüber diesem utopischen Bilde, über dessen Ver-
hältniss zu den humanitär-socialistischen Idealen wir uns im nächsten
Capitel noch weiter auslassen wollen, wollen wir nun in kurzen
Grundlinien das Bild skizziren, das unsere heutige Gesellschaft
darbietet.Vgl. Schäffle, A. Bau und Leben des socialen Körpers. 4 Bde.
Tübingen. 1881. Was die sexuelle Auslese und die Rücksicht auf die
Erzeugung guter Devarianten anlangt, so hat schon Darwin die heutigen
Verhältnisse als erbärmlich genug hingestellt. Am Ende des zweiten
Theils seiner „Abstammung des Menschen“ lässt er sich folgendermaassen
darüber aus: „Der Mensch prüft mit scrupulöser Sorgfalt den Charakter
und den Stammbaum seiner Pferde, Rinder und Hunde, ehe er sie paart.
Wenn es aber zu seiner eigenen Heirath kommt, nimmt er sich selten oder
niemals solche Mühe. Er wird nahezu durch dieselben Motive wie die
niederen Thiere, wenn sie ihrer eigenen freien Wahl überlassen sind,
angetrieben, obgleich er insoweit ihnen überlegen ist, dass er geistige
Reize und Tugenden hochschätzt. Andrerseits wird er durch blosse
Wohlhabenheit oder durch Rang stark angezogen … Wenn die Principien der
Züchtung und der Vererbung besser verstanden werden, werden wir nicht
unwissende Glieder unserer gesetzgebenden Körper- schaften verächtlich
einen Plan zur Ermittelung der Frage zurückweisen hören, ob
blutsverwandte Heirathen für den Menschen schädlich sind oder nicht.“
Irgend eine Beschränkung des niedrigst zulässigen Heirathsalters in
annehmbarer Weise haben wir in keinem Culturstaat, überall ist es zu
früh angesetzt, in manchen Ländern auf 16, bezw. 14, ja 12 Jahre. Auch
die öffent- Meinung ist viel zu stumpf in diesem Punkt. In Thüringen,
Oldenburg und Braunschweig, deren Statistik Material dafür liefert,
wurden im Durchschnitt der Jahre 1876—80 53502 Kinder geboren, davon
13023, oder etwa ein Viertel, ehe die Mutter 25 Jahre alt war. In
Berlin betrug für 1878 ‒ 80 dieser Bruchtheil 23,8 %.Statistik des
Deutschen Reichs. Neu Folge, Bd. 44. S. 142. In den Neuengland-Staaten
sind unter den Eheschliessenden 15—25 % der Frauen unter 20 Jahren und
etwa 60 % von ihnen unter 25 Jahren, von den heirathenden Männern
stehen etwa 40 % unter 25 Jahren. Nach den Arbeiten von KörösiKörösi,
J. Ueber den Einfluss des elterlichen Alters auf die Lebenskraft der
Kinder. Hildebrand’s Jahrb. für National- Oeconomie und Stat. 3. Folge,
4. Bd. S. 518. ist es zweifellos, dass die Kinder, die vor der völligen
Reife der Mütter gezeugt werden, lebensschwächer sind, und dass man
diese völlige Reife der Mütter für gewöhnlich zu früh ansetzt. Ein
Ausschliessen offenbarer Schwächlinge und Kranker von der Fortpflanzung
findet nur in seltenen Fällen statt. Krethi und Plethi heirathet lustig
drauf los. Kränkliche Menschen, alte Roués heirathen manchmal nur zu
dem Zweck, eine Pflegerin zu bekommen, und wenn dabei dann nebenher
noch so ein Häufchen Jammer auf die Welt kommt, wird es noch mit aller
möglichen Sorgfalt auf- gepäppelt. In neuerer Zeit bemühen sich fromme
Damen sogar als Heirathsvermittler zwischen Blinden und Taub- stummen.
Auch von kräftigen Gatten werden oft genug minder- werthige Kinder
gezeugt, weil sie die zwar der Wissenschaft bekannten, aber in Folge
unserer vortrefflichen Erziehung ihnen selbst nicht zu Ohren gekommenen
günstigen Zeugungsbedingungen nicht zu benutzen und die ungünstigen
nicht zu vermeiden verstehen. Da wird so manches Kind im halben Rausch
oder kleineren Bruchtheilen dieses herr- lichen Zustandes gezeugt, das
sonst viel besser gerathen wäre. So mancher Sprosse starker
Geschlechter büsst etwas von ihrer Constitutionskraft ein, weil der
Vater ein unmässiger Raucher war, oder die Mutter ihren kräftigen
Körper durch fortdauerndes starkes Schnüren zart und schlank machen
wollte und sich so Gebärmutter-Krank- heiten zuzog. In anderen Fällen
wieder werden die Kinder so rasch hinter einander gezeugt, dass die
Mutter und der spätere Nachwuchs schwer geschädigt werden, ganz zu
geschweigen von den noch immer zahlreichen Fällen, in denen nach dem
ersten halben Dutzend Kinder ein zweites, wie wir auf S. 59 sahen, sich
stetig verschlechterndes folgt.In Berlin machten 1891 die Kinder vom
Sechstgeborenen (einschliesslich) aufwärts ein Sechstel aller Geborenen
aus. Was die Kinderpflege anlangt, so wird auch hier in mannigfachster
Weise gegen die reinen rassenhygienischen Forderungen gesündigt.
Schwächliche Mütter besorgen sich Ammen, Soxhlet’sche
Sterilisationsapparate und allerlei Kindernährmittel und vererben auf
diese Weise häufig ihre flachen Brüste und sonstige Mängel ihrer
Constitution. Wenn die natürliche Auslese der Schwachen doch in Form
von allerlei Kinderkrankheiten, besonders Ver- dauungsstörungen und
Entzündungen der Athmungsorgane in ihr Recht treten will, kommt der
Arzt dazwischen und bereichert in vielen Fällen die Menschheit um eine
schwache Constitution, die sich später oft nur selbst zur Last wird.
Bei der Erziehung wird nicht Jedem die gleiche Chance gegeben, sondern
der, dessen Eltern wohlhabend sind, geniesst von Anfang an eine bessere
Ausbildung als der Sohn des Proletariers. Dagegen wäre vom Standpunkt
des Rassenwohls dann nicht viel einzuwenden, wenn der Vermögensstand
der Eltern die directe Folge ihrer wirth- schaftlichen Fähigkeiten
wäre. Das ist aber sehr häufig durchaus nicht der Fall, da viele
Vermögen sich bereits seit Generationen forterben und auch in ihrer
ersten Entstehung häufig genug auf Lug und Trug oder Gewalt beruhen.
Auch das Erbrecht, das bei dem Wettkampf um die Nährstellen den einen
Theil der Bewerber von vorn herein günstiger stellt oder ihn überhaupt
jeden Kampfes über- hebt, steht noch in voller Glorie. Dass dieser
Theil nicht rein mit dem besten zusammenfällt, ist bekannt. Hierdurch,
sowie durch starke nonselectorische Schädlichkeiten im Gebiet des
wirthschaftlichen Lebens ist die Armuth, um die auch sonst heute das
grösste Gewirr von Fragen schwärmt, oft betrachtet worden als ein
Schicksal, das die Menschen ohne Rücksicht auf ihre Eigenschaften
überfällt, so be- sonders oft von den Socialisten. Andere wieder haben
allzu stark betont, dass die Armen stets nur wegen ihrer Inferiorität
arm sind, und dass man sie zu identifiziren habe mit den Unterlegenen
des Kampfes um’s Dasein. Armuth. In Wirklichkeit ist allerdings die
Armuth eine Ausjäte- Erscheinung, die Schwächsten fallen ihr am ehesten
zum Opfer. Allein dies ist doch nicht immer der Fall, eine
beträchtliche Quote der Armuth, wie z. B. ein Theil des Krisenelends
ist sicher nonselectorischen Charakters. Jeden- falls besitzen wir in
dem oekonomischen Kampf um’s Dasein eine ausserordentlich wirksame Art
der natürlichen Auslese. Dies behält dadurch nicht minder seine
Bedeutung, wenn wir zugeben, dass die Armuth in Folge unserer
wirthschaft- lichen EinrichtungenVgl. Marx, Karl. Das Capital. I. Bd.
III. Aufl. Hamburg 1883. in beinahe demselben Grade be- bestehen würde,
wenn alle Individuen gleich hoch begabt wären. Es trifft nur eben nicht
zu, dass „alle Menschen, gleich geboren, sind ein adliges Geschlecht,“
sondern so sehr es in vielen Fällen unmöglich ist, zwischen ursprüng-
licher Anlage und späteren Wirkungen der Umgebung zu unterscheiden, so
wird doch kein Naturwissenschaftler, am wenigsten ein Arzt, die grossen
natürlichen Unterschiede in den Anlagen der Menschen abläugnen. Wir
wollen die ökonomische Ausjäte hier noch etwas genauer in’s Auge
fassen, da sie auch für das nächste Capitel, in dem die Folgen ihres
Fortfalls besprochen wer- den sollen, eine hervorragende Bedeutung hat.
Besonders wird es nöthig sein, das Märchen vom gesunden armen Mann, dem
seine frugale Lebensweise die Kraft erhalten hat, mit der Statistik zu
confrontiren, um zu sehen, ob etwa dadurch die ausjätende Potenz der
Armuth in Frage gestellt wird. Zur ökonomischen Ausmerzung würde jede
Schädi- gung der Individuen in Zeugung und Kinderpflege aus Mangel oder
aus einem Zuviel an sogenannten wirthschaft- lichen Tugenden gehören,
indem die nothwendigen Güter zur Gewinnung eines Gatten und zur Pflege
der Kinder, natürlich auch zur eigenen Erhaltung nicht gesammelt oder
bewahrt werden können. Die Zahl der Nährstellen ist eine stets
schwankende, hier anschwellend, z. B. durch Eröffnung neuer Siedelungs-
oder Waarenabsatz-Gebiete, dort zurückgehend durch Krisen oder stark
arbeitsparende Maschinen. Aber stets ist sie auf die Dauer eine
verhältnissmässig beschränkte und zwingt desshalb, abgesehen von den
nonselectorischen Momenten in Krisen, Strikes, Lockouts, zum
wirthschaftlichen Kampf um’s Dasein unter den zu zahlreichen Bewerbern.
Die Eigenschaften, die darin zum Siege helfen, sind bei der
Verschiedenheit der Anforderungen, die an diese Bewerber um die
verschiedenen Nährstellen gestellt werden, jeden- falls sehr
mannigfaltig. Im Grossen und Ganzen kann man aber doch sagen, dass sie
bestehen in einer guten Con- stitutionskraft, vor allem gut
entwickelter Intelligenz und Arbeitskraft, einigen moralischen
Hemmungen, einem ge- wissen Verhältniss von Altruismus und Egoismus und
last not least einer ziemlichen Fähigkeit zu lügen und zu heucheln. Die
gute Constitutionskraft sichert geistige und körper- liche
Arbeitsfähigkeit und Widerstandskraft gegen die Schäd- lichkeiten der
Arbeit. Ihr Intelligenztheil zeigt den Haupt- punkt bei aller
Wirthschaft, das richtige Verhältniss zwischen Kostenwerth und
Gebrauchs-, bezw. Tauschwerth, zwischen Ausgabe und Einnahme,
vergrössert die Ergiebigkeit der Arbeit und schützt vor dem Strafgesetz
und sonstigen allzu starken Conflicten mit Gesellschaft oder den
Individuen. Die moralischen Hemmungen leisten dieses Letztere eben-
falls, nur auf anderem Wege. Das richtige Verhältniss altruistischer
und egoistischer Neigungen sorgt für ein günstiges, die
Individual-Wirthschaft nicht beeinträchtigendes Verhältniss zwischen
den empfangenen Leistungen, wie sie den Altruisten vielfach von den
Nebenmenschen zu Theil werden, und den Rückleistungen, die der Egoismus
nicht zu hoch ansteigen lässt. Es giebt natürlich auch genug Fälle, wo
ein ungemischter Egoismus — auch ohne non- selectorische Glücksmomente
— den grössten wirthschaft- lichen Erfolg davonträgt, wie z. B. im
Falle Jay Gould’s, allein für die grosse Masse trifft das wohl kaum zu,
mindestens muss ein gewisses Maass von Altruismus geheuchelt werden.
Was die Heuchelei anlangt, so weiss Jeder, dass oft genug, abgesehen
von den directen Lügen aus Habgier, von den conventionellen Lügen bis
zur groben Heuchelei alles auf- gewandt wird, um den Anschauungsabstand
von den Mit- menschen nicht zu gross erscheinen zu lassen. Sonst würde
für einen Bewerber um wirthschaftliche Gunst die Gefahr zu gross, von
einem Anderen verdrängt zu werden, dessen zur Schau getragene Meinungen
in dem Gehirn des Gunst- verleihers nicht so viele Reibungen
verursachen. Nebenbei gesagt, liegt hierin eine grosse und allge- meine
Entwürdigung, in die das heutige capitalistische System die übergrosse
Mehrzahl der Menschen hineinzwängt. Die Ausmerzung nun in diesem
wirthschaftlichen Kampf um’s Dasein besteht hauptsächlich aus
Folgendem: erstens Tod in Folge von Hunger oder Krankheiten, die durch
Mangel, Schmutz, Unwissenheit, Sorgen und andere Be- gleiterscheinungen
der Armuth entstehen, kurz Armuths- Sterblichkeit; zweitens
Ehelosigkeit oder verminderte Kinder- zeugung durch absolute oder
relative Armuth, auch Ar- muths-Krankheiten, sowie durch sonstige
geistige und körperliche Folgezustände der Armuth, kurz Armuths-
Praevention; endlich drittens jede Schädigung, von denen die Keime und
die Kinder während der Zeit ihres Heran- wachsens durch die Armuth der
Eltern getroffen werden. Die Schädigungen dieser letzten Kategorie
würden natür- lich für eine spätere Zeit auch entweder auf Armuths-Tod
oder Armuths-Praevention hinauslaufen, so dass es nur dann Werth hat,
diese Kategorie überhaupt aufzustellen, wenn die gesammte
wirthschaftliche Ausjäte zu einem ge- gebenen Zeitpunkt betrachtet
werden soll. Um nun den Inhalt der wirthschaftlichen Ausjätung etwas
specialisiren zu können, wollen wir die Einflüsse der Armuth
schlechtweg auf Gesundheitszustand, Eheschliessung und Geburtenziffer
in’s Auge fassen. Das ist insofern nicht ganz correct, als die Armuth
in ihrer Gesammtheit nicht die Folge des wirthschaftlichen Kampfes um’s
Dasein allein ist, sondern ausserdem giebt es ja noch die Armuth durch
die nonselectorischen Einflüsse der Krisen, der Einführung von
Maschinen etc. und des blossen Umstandes der Geburt in Familien, die
durch solche nonselectorischen Momente arm geworden sind. Aber der
Fehler bezieht sich haupt- sächlich nur darauf, dass der Begriff der
Gesammt-Armuth ein quantitativ umfassenderer ist, als der der
wirthschaftlichen Ausjäte, ihre spezielle Beschaffenheit und die Art
ihrer Folgen sind so ziemlich dieselben. Höchstens könnte man anführen,
dass bei der nonselectorischen Armuth die Ent- artung des
Familienlebens und das hoffnungslose Erlahmen nicht so häufig eintritt
eben durch das öftere Vorhanden- sein guter wirthschaftlicher
Eigenschaften, so dass also die nonselectorische Armuth im Allgemeinen
die weniger schäd- liche Art wäre. Allein es ist unmöglich, darüber
eine ge- gründete Meinung auszusprechen, da wohl in sehr vielen Fällen
die guten wirthschaftlichen Eigenschaften den Ar- muths-Einflüssen bald
zur Beute fallen. Eine vage Anschauung von dem gegenseitigen Verhältnis
des selectorischen und nonselectorischen wirthschaftlichen Untergangs
in gewissen Kreisen des Volks mögen folgende von dem World AlmanacThe
World Almanac und Encyclopedia. New-York 1894. S. 176. nach
Bradstreet’s Journal gelieferten Zahlen geben. Von den 12394
Bankerotten des Jahres 1891 in den Vereinigten Staaten von Amerika
kamen in Procenten auf folgende Ursachen und hatten folgende Procente
der Gesammtverpflichtungen aller Bankerotteure: Den Posten mit der
Bezeichnung Mangel an Capital müssen wir aus der Betrachtung
fortlassen, da in ihm ja schon viele Ärmere inbegriffen sind, was auch
dadurch documentirt wird, dass der Antheil dieses Postens an den
Verpflichtungen (32 %) ein gut Theil hinter seinem Antheil an der Zahl
der Bankerotte (39,2 %) zurückbleibt. Von den noch übrig bleibenden 61
% können wir 34, d. h. etwa die Hälfte, eher als wirthschaftliche
Ausjäte betrachten, nämlich die Posten Unfähigkeit, Unerfahrenheit,
unkluger Credit, Verschwendung, Nachlässigkeit, Speculation und Betrug,
und 27, die kleinere Hälfte, eher als Folge non- selectorischer
wirthschaftlicher Factoren ansehen, nämlich die Posten Bankerott
Anderer, Concurrenz, Unglücke und Krisen. Einen exacten Werth können
diese Zahlen natürlich schon deshalb nicht haben, weil die wahren
Ursachen der Bankerotte nicht immer leicht festzustellen sind. Wir
haben demnach gar keine andere Möglichkeit, als uns an die
Gesammt-Armuth zu halten. Eine Betrachtung der Beziehungen der Armuth
zur Constitutionskraft und zur Qualität der erzeugten Devarianten ist
nicht nur nothwendig, um die Folgen der ökonomischen Ausjätung zu
charakte- risiren, sondern wir müssen auch die der nonselectorisch
entstandenen Armuth näher kennen lernen, um die Be- deutung dieses
letzteren Factors für den Rassenprocess würdigen zu können. Was
zunächst den directen Hungertod anlangt, so mag er ja in seiner acuten
Form nicht so sehr häufig auftreten, trotzdem z. B. 1887 in London in
36 Fällen der Tod durch buchstäbliches Verhungern von den
Leichenbeschauern constatirt wurde. Allein in der langsamen indirecten
Form, die kaum noch mit Hungergefühl ausser grade nach andrer und
besserer Nahrung einhergeht, ist er häufiger, indem die mangelhafte
Ernährung das Auftreten vieler Krank- heiten erleichtert und ihren
Verlauf schlimmer gestaltet.In Bezug auf die grosse Erkrankungsziffer
der niederen Volks- schichten findet sich viel Material in den
Berichten der verschiedenen Fabrikinspectoren; besonders instructiv ist
die ausgezeichnete Arbeit der Herren Dr. F. Schuler, eidgenössischer
Fabrikinspector in Mollis Man hört so oft von der Gesundheit reden, die
dem Armen als Lohn für seine einfache Lebensweise zu Theil wird,
gegenüber der Kränklichkeit des Wohlhabenden in Folge üppiger
Lebensweise, und tritt auch wohl manchmal mit dieser Behauptung allzu
unzufriedenen Elementen entgegen. Allein die Statistik lehrt doch etwas
ganz Anderes. Über die Morbidität und Mortalität der Gesammtheit der
Armen und der der Wohlhabenden in einem Lande ist mir nur wenig
Material zugänglich. Was das allmählige Erlöschen der Familien des
hohen Adels anlangt, so spielen dabei Inzucht, künstliche Verminderung
der Geburten und häufiges Heirathen von Erbinnen, d. h. Töchter kinder-
armer Eltern, eine ziemlich bedeutende Rolle. Im übrigen aber steht
Morbidität und Mortalität unter sonst gleichen Umständen im umgekehrten
Verhältniss zum Einkommen. Einige Zahlen mögen dies für die
Sterblichkeit, resp. das durchschnittliche Lebensalter darthun. „Für
England hat die Berufs-Statistik als durchschnitt- liches Lebensalter
festgestellt: in den höheren Klassen 44 Jahre in dem niederen
Mittelstand 26 „ bei den arbeitenden Klassen 22 „ Nach derselben Quelle
beträgt die Sterblichkeitsziffer für das ganze Land 22 ‰ für den
Wohnsitz der höheren Klassen 17 „ für die Arbeiter-Districte 36 „ und
Dr. A. E. Burkhardt, Professor für Hygiene in Basel: Ueber die
Gesundheitsverhältnisse der Fabrik-Bevölkerung in der Schweiz, ferner
die Arbeit von Dr. H. Rauchberg: Ueber die Erkrankungs- und
Sterblichkeits-Verhältnisse bei der allgemeinen Arbeiter-Kranken- und
Invalidenkasse in Wien 1887. Einen kurzen Auszug daraus giebt Dr. H.
Lux in seinem geschickt zusammengestellten Socialpolitischen Handbuch.
Berlin 1892. — Vgl. ferner Engels. Fr. Die Lage der arbeitenden Klassen
in England. II. Aufl. 1892. — Marx, K. Das Kapital. 1. Band. III. Aufl.
Hamburg 1883. Dr. Anderson Lux, a. a. O. S. 68. Daselbst auch Angabe
voriger Seite. in Dundee wies nach, dass bei einer Gesammtsterblichkeit
von 20,7 ‰ die Sterblichkeit je nach der verschiedenen Grösse der
Wohnung, die ja ein indirecter Maasstab des Einkommens ist, sich
folgender- maassen verhält: in Wohnungen mit 4 und mehr Zimmern 12,3 ‰
„ „ „ 3 „ 17,2 „ „ „ „ 2 „ 18,8 „ „ „ „ 1 „ 23,3 „ VillerméCitirt in
Haushofer, Lehr- und Handbuch der Statistik. Wien 1882. macht für Paris
interessante Angaben über das Verhältniss der Wohnungspreise in den
einzelnen Quartiren zu der Sterblichkeit in ihnen von 1821—1826. Der
bekannte Statistiker KolbCulturgeschichte der Menschheit. III. Aufl.
Leipzig 1885. S. 33. äussert sich folgender- maassen über den
ausjätenden Einfluss der Armuth: „Wohl- stand und Armuth sind es,
welche auf das Gedeihen und Verkümmern der Menschen am gewaltigsten
einwirken! Heirathen, Geburten und Sterbefälle vermehren oder ver-
mindern sich mit den Preisen der Lebensmittel und der
Arbeitsgelegenheit. In dem ziemlich ausgedehnten Zeit- raume von
1694—1784, also in 90 Jahren, betrug die durch- schnittliche
Sterblichkeit zu Paris: in den 10 theucrsten Jahren je 21174
Sterbefälle „ „ 10 wohlfeilsten „ „ 17529 „ Ebenso zählte man zu
London: in 7 englischen Grafschaften: Nicander fand, das in Schweden
die Zahl der Sterbe- fälle durch die Theuerung vermehrt wurde: im Jahre
1762 um ⅕, 1763 um 1/7, 1772 um ¼, 1733 um ⅓, 1799 um 1/7, 1800 um ⅙.
Die Wirkung der Theurung ist aber um so furchtbarer, da nicht die
Gesammtheit der Einwohner ihren gleichmässigen Beitrag zu dieser
Vermehrung der Todesfälle liefert, sondern die ganze Erhöhung zunächst
von den Armen herrührt, welche also nicht etwa bloss 1/7, ¼ u. s. w.
mehr als gewöhnlich an Todten liefern, sondern noch ungleich härter
betroffen werden, da sie auch einen grossen Theil der auf die Reichen
treffenden Quote zu liefern haben. In Übereinstimmung hiermit zeigt
sich dann auch die gewaltige Einwirkung von Wohlstand oder Armuth, wenn
wir nicht bloss einzelne Jahre sondern die Lebensverhältnisse ganzer
Menschenklassen in’s Auge fassen. Die Schriften von Benviston, Morgan,
Dr. Casper und Quetelet enthalten reiches Material. Nach Caspar’s
Untersuchungen leben von 1000 zu gleicher Zeit geborenen Menschen nach
Die Zahlen der ersten Colonne (Wohlhabende) nahm Caspar aus
Zusammenstellungen der bei adligen Familien eingetretenen Sterbefälle,
jene der zweiten (Arme) aus den Listen der seit vielen Jahren in Berlin
verstorbenen Stadt- armen. — Die mittlere Lebensdauer stellt sich bei
den Reichen auf 50, bei den Armen nur auf 32 Jahre. … Das
Missverhältniss tritt, wie man sieht, schon in der frühesten Zeit ein,
es dauert aber im höheren Alter ohne Minderung fort und wäre noch
ungleich grösser, wenn sich die Reichen nicht häufig durch ein
Übermaass von Genüssen selbst das Leben verkürzten; Villermé’s
Beobachtungen stimmen damit überein. Er ermittelte, dass in dem mehr
von Reichen bewohnten 1. Stadtbezirk von Paris jährlich nur 1/53, in
dem mehr von Armen bewohnten 12. Bezirk mindestens 1/40 der
Gesammtbevölkerung starb. Ebenso entreisst der Tod in den wohlhabenden
Departements Frankreichs jährlich 1/53, in den armen 1/46 der Ein-
wohnerschaft. Lord Ebrington fand zu London eine durch- schnittliche
Sterblichkeit von 25‰, jedoch stieg sie in einigen Quartieren auf 40,
während sie in andern nur 13 betrug. Ebenso berechnete er an einigen
Orten eine mittlere Lebensdauer im Handwerkerstande von 19—20, in der
Klasse der Handelsleute und Gentlemen eine von 40—45 Jahren. Und dabei
darf nicht übersehen werden, welche bedeutende Annäherung der Ziffern
dadurch stattfindet, dass nirgends bloss Reiche, nirgends bloss Arme
vorhanden sind; schon der partielle Unterschied erzeugt solche Ab-
weichungen. Thatsachen dieser Art — und die Zahl der Beispiele liesse
sich ungemein vermehren — führen von selbst zu dem Axiom: Je geringer
die Civilisation und der Wohlstand, je grösser die Uncultur und das
Elend, desto furchtbarer rafft der Tod die Menschen hinweg; mit der
Cultur und dem Wohlstand erhöht sich die Lebensdauer.“ Wie eine
schlechte Ernährung auch das Zurückbleiben der allgemeinen
Körperentwicklung bedingt, zeigte Keleti durch Nachweis der Harmonie,
die in den einzelnen un- garischen Comitaten zwischen dem auf den Kopf
kommenden Eiweiss-Gehalt der Nahrung und der Zahl der Militär-
tauglichen besteht. Keleti, Dr. Karl. Die Ernährungstatistik der
Bevölkerung Ungarns auf physiologischer Grundlage bearbeitet.
Uebersetzung aus den ungarischen Amtlichen statistischen Mittheilungen.
Budapest. 1887. Refer. im Arch. f. soc. Gesetzgeb. u. Statistik. 1. Bd.
S. 346. Tübingen 1888. Was die Verfolgung der näheren Art und Weise an-
langt, wie die Armuth durch schlechte Ernährung, enge Wohnung, Schmutz,
Unwissenheit, Prostitution, Zwang zur Arbeit unter
gesundheitsschädlichen Bedingungen u. s. w. eine Schädigung der
Entwickelung, Krankheit und früh- zeitigen Tod hervorbringt, so führt
das zu weit ab in’s medicinische Gebiet. Die Armuths-Krankheiten
vermindern unter den von ihnen Betroffenen natürlich die
Eheschliessungen und die Zahl der Nachkommenschaft und liefern dadurch
Material für die Armuths-Praevention. Aber die Armuth wirkt auch
praeventiv in mehr directer Weise. Ein Theil der ärmeren Männer scheut
die Kosten der Ehe, als Zuflucht bleiben ja die Prostituirten, und ein
Theil der ärmeren Mädchen bleibt wegen zu geringer Mitgift
unverheirathet oder fällt durch Noth und Verführung der Prostitution
zum Opfer, wobei die Wahrscheinlichkeit sich zu verheirathen und Kinder
zu erzeugen bekanntlich minimal, dagegen die Sterblichkeit gross ist.
Dass die Prostitution sich so gut wie ausschliess- lich aus armen
Mädchen rekrutirt, zeigt eine Ermittelung des Berliner
Polizei-PraesidiumsLux, a. a. O. pag. 135. in den Jahren 1871 bis 1878
über den vorherigen Erwerb von 2224 Prostituirten. Darnach waren
Dienstmädchen 794 = 35,7 % Fabrikarbeiterinnen 355 = 16,0 „ in
Hausindustrie und Ladengeschäft 936 = 42,0 „ Aufwärterinnen in
Verkaufslokalen 139 = 6,3 „ 11 Parent Duchatelet fand unter 3084
Prostituirten nur drei Bemittelte mit einem jährlichen Einkommen von
300 bis 1000 Franken. Der Antheil, den defecte Gehirnanlagen an den
Ursachen der Prostitution haben, ist also nicht so aus- schlaggebend,
wie man nach TarnowskyCitirt in Ploss, Das Weib. III. Auflage. Leipzig
1891. S. 345. und Lom- brosoLombroso, C. und Ferrero. Das Weib als Ver-
brecherin und Prostituirte. Deutsch von Kurella. Hamburg 1894. glauben
könnte, sondern die Armuth spielt als Quelle ebenfalls eine bedeutende
Rolle. Bei den schlecht bezahlten Arbeitern, besonders in Gegenden, wo
viel Frauenarbeit herrscht, scheint das ge- ringe Einkommen die Ehe
nicht so leicht zu hindern, als andere Momente in den höheren Ständen.
Die Ehen werden wenigstens bei den Arbeitern im Durchschnitt früher
geschlossen. Nach einer officiellen englischen Sta- tistikNeue Zeit.
1887. pag. 190. aus den Jahren 1884 und 1885 ist das durchschnitt-
liche Heirathsalter der Bergwerksarbeiter 23,56 Jahre Arbeiter in
Textilfabriken 23,88 „ Schuster und Schneider 24,42 „ geschickten
Arbeiter 24,85 „ Taglöhner 25,06 „ Handlungs-Commis 25,75 „
Detail-Händler 26,17 „ Pächterssöhne 28,73 „ Gebildeten und
Unabhängigen 30,72 „ Übrigens darf man grade in Bezug auf
Eheschliessung die Armen schlechtweg durchaus nicht als die Unter-
liegenden ansehen. Das Unterliegen ist relativ und richtet sich nach
der gewohnheisgemässen Lebenshaltung der Concurrirenden; der Kampf wird
also, wie in mancher an- deren Beziehung, zum grossen Theil innerhalb
der Stände ausgefochten. Ein reicher Adliger z. B. unterliegt im Kampf
um die Familie oft schon, wenn er auf eine Lebenshaltung herabgedrückt
wird oder werden soll, die dem gewöhnlichen Arbeiter noch als sehr hoch
vorkommt. So muss man verschiedene, natürlich nicht scharf abgegrenzte
Classen von Lebenshaltungen unterscheiden, deren Mitglieder den Kampf
um die Familie schon von Anfang an auf einer andern Basis ausfechten.
Aber diese Art relativer ökono- mischer Ehehindernisse erscheint doch
immer, auch bei Wohlhabenden, im Gefolge einer wirthschaftlichen
Schädi- gung selectorischer oder nonselectorischer Natur oder im
Gefolge der Furcht vor einer solchen Schädigung, gehört also durch
ihren selectorischen Theil zur wirthschaftlichen Ausjäte. Es wird
interessant sein, einige Zahlen über die Ehe- losigkeit überhaupt
anzuführen. In Berlin waren 1890 24 % der Männer, die über 25 Jahre,
und 31 % der Frauen, die über 20 Jahre waren, ledig. In den Jahrgängen
von 30 bis 35 waren von den Männern noch über 27 % ledig, in den
Jahrgängen von 35 bis 40 bei den Männern über 15 %, bei den Frauen über
17 %, wobei die grössere Sterblich- keit der Ledigen ihr Verhältniss zu
den Verheiratheten und damit auch die Rate der sexuellen Ausjäte noch
günstiger erscheinen lässt, als sie in Wirklichkeit ist. Für das
Deutsche Reiche und einige andere Staaten geben folgende Ziffern
Statistik des Deutschen Reichs. Neue Folge. Bd. 44. Berlin 1892. einen
Anhalt: Es waren in den 70er Jahren ledig in 11* Complicirter liegen
die Dinge bei dem Theil der Armuths-Ausmerze, der sich direct in der
Verminderung der Geburten kundgiebt, die auf eine Ehe kommen könnten.
Es ist wohl keine Frage, dass durch die Armuth insofern ein
vermindernder Einfluss ausgeübt wird, als die Sterblich- keit der Armen
eine grössere ist und also oft genug zu frühzeitigem Aufhören der
Kindererzeugung führen muss. Dieser Einfluss wird sich besonders
zeigen, wenn man die Kinderzahl pro Ehe bei der industriellen
Reserve-Armee, den Ärmsten unter den Armen, vergleicht mit derjenigen
der mehr stetig beschäftigten, wenn auch immerhin noch armen Arbeiter.
Auch unter letzteren werden die durch vorzeitigen Tod gelösten Ehen
zahlreicher sein als unter den wohlhabenden Classen. Allein diesem
Einfluss steht ein viel mächtigerer ent- gegen: mit zunehmendem
Einkommen vermindert sich im Grossen und Ganzen die Zahl der Geburten,
die auf eine Ehe kommen. Marx sagt: „In der That steht nicht nur die
Masse der Geburten und Todesfälle, sondern die absolute Grösse der
Familien im umgekehrten Verhältniss zur Höhe des Arbeitslohnes.Marx,
Karl. Das Kapital. I. Bd. III. Aufl. Hamburg 1883. S. 661.
DumontDumont, A. Dépopulation et civilisation. Paris 1890. pag. 80 und
folg. erklärt: „Es giebt kaum etwas Gesicher- teres in der Demographie,
als dass das Elend fruchtbar, der Reichthum und die Wohlhabenheit
verhältnissmässig unfruchtbar sind.“ Er citirt Legoyt, (Revue
scientifique, 4. Sept. 1880): „Nach den Arbeiten von Quételet für
Brüssel, W. Farr für London, de Villermé und Benoiston de Chateanneuf
für Paris wird das Maximum der Geburten erzeugt in den Quartieren der
arbeitenden Klassen und das Minimum in den Quartieren der Reichen oder
der einfach Wohlhabenden.“ Der Grund dieser Erscheinung liegt wohl nur
zum allerkleinsten Theil darin, dass wohlgenährte Eltern rein
physiologisch eine geringere Zeugungspotenz haben als schlecht
genährte. Die Aerzte wissen zwar, dass Fettsucht unfruchtbar machen
kann, allein über den Einfluss der blossen guten Ernährung und des
behaglichen Lebens überhaupt auf die Fruchtbarkeit der Menschen liegen
keine einwandsfreien Beobachtungen vor. Darwin kommt bei der
Betrachtung dieses Gegenstandes zu dem von den Hausthieren abge-
leiteten Analogie-Schluss, man dürfe erwarten, dass civilisirte
Menschen wegen ihrer nahrhaften Kost frucht- barer seien als
wilde.Darwin. Abstammung des Menschen. Deutsch von Carus. 1. Bd. S. 57.
Es wäre auch wohl anzunehmen, dass eine eventuelle rasche Abnahme der
Zeugungskraft der Wohlhabenden sich nicht nur in der Menge, sondern
auch in der Güte der Kinder offenbaren würde, wogegen die bessere
Entwickelung der Kinder von Wohlhabenden spricht. Es bleibt nur übrig,
den Hauptgrund der Er- scheinung in der grösseren Abneigung der
Wohlhabenden gegen Kinderzeugung und -Pflege zu suchen und in ihrer
grösseren Macht, Zeugung und Geburt zu verhindern. Abneigung der Eltern
gegen eine grössere Zahl Kinder besteht wohl ausnahmslos sowohl bei den
Armen, wie bei den Wohlhabenden. Mir ist auf zahlreiche Anfragen noch
nie der Bescheid geworden, dass mehr wie zwei bis drei Kinder erwünscht
seien. Im Gegentheil wurden mir sogar von wohlhabenden, verheiratheten
Frauen nicht nur prae- ventiver Verkehr, sondern auch mehrfacher
künstlicher Abort eingestanden. Eine kinderlose Amerikanerin erzählte
mir in der Consultationsstunde in der harmlosesten Weise, sie hätte
drei künstliche Fehlgeburten durchgemacht. Dabei hat sie Kinder sehr
gern und scheut sogar kleine Reisen nicht, um hübsche Babies zu
besuchen, von Katzen und Hunden, die sie hält, ganz zu schweigen. Trotz
Mutter- instinct also keine Kinder. Man scheut die Mühen und die
Gefahren der Schwangerschaft und Geburt, die Unbe- quemlichkeit und die
Kosten der Kindererziehung, den Ver- lust der schönen Leibesformen und
vor Allem auch die Beeinträchtigung der eigenen Bewegungs- und
Vergnügungs- Freiheit durch die Kinder. Dass diese Hemmungen bei den
besseren Klassen stärker ausgesprochen sind als bei den niederen, kann
nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt, dass die Mitglieder der ersteren
im Allgemeinen feinfühliger sind, und dass ihnen die Vergnügungen in
ganz anderer Art zugänglich sind, als den Armen. Dasselbe gilt für
einen weiteren, rein wirthschaftlichen Grund der Kinder-Beschränkung:
man will den bereits erzeugten Kindern keine neuen Mitbewerber schaffen
in Bezug auf gute Ausbildung und Erbtheilung. Bei den ärmeren Classen
spielt das eine geringe Rolle, sie haben ihren Kindern keine Erziehung
zu geben und kein Erbe zu hinterlassen; im Gegentheil, wenigstens die
Fabrik- und besitzlosen Landarbeiter können von einem grösseren Nach-
wuchs eher Vortheil erhoffen, da die Kinder früh selbst verdienen
können und als eine Art Alters-Versicherung angesehen werden. Noch ein
weiteres Moment müssen wir in Betracht ziehen. Haben die Wohlhabenden
schon in höherem Maasse das Bestreben, die Kinderzahl zu beschränken,
so kommt noch hinzu, dass es ihnen auch bedeutend leichter ist, ihr
Bestreben durchzuführen. Sie haben erstens durch ihre vorwiegend
geistige Beschäftigung mehr Übung in der Selbstzucht, sie können sich
besser „vorsehen“, ein Um- stand, der besonders bei der so häufigen
Form des coitus interruptus eine Rolle spielt. Sodann sind sie durch
Lectüre und Aerzte besser über die Technik des praeventiven Verkehrs
unterrichtet und können sich Pessare, Condome etc. eher verschaffen.
Und was nicht gering angeschlagen werden darf, Hebamme, Apotheker und
andere Helfer können eher bezahlt, also benutzt werden. Die
Praeventiv-Mittel sind eben alle nicht ganz sicher, bei Armen wie bei
Reichen „passirt“ doch manchmal etwas. Die ärmere Frau kann nur
unvollkommene Anstrengungen machen, „ihre Regeln wieder zu bekommen“,
die wohlhabende dagegen findet oft genug Hände bereit, ihr aus der Noth
zu helfen. Man braucht nur einen Blick in den Annoncen-Theil gewisser
grossstädtischer Blätter zu werfen, um zu erfahren, wie ausgedehnt
dieses Geschäft betrieben wird. Bebel, August. Die Frau. S. 53. Ploss
sagt: „Es ist bekannt, dass unter den Weissen Nord-Amerika’s die
Abtreibung sehr üblich ist, und dass insbesondere in allen grossen
Städten eigene Anstalten existiren, in denen Mädchen und Frauen eine
frühzeitige Entbindung bewerk- stelligen.“. Ferner: „Auch in Europas
grossen Städten scheint die Frucht-Abtreibung überhand zu nehmen. …
Nach der Ansicht aller Sachverständigen wird die Frucht- abtreibung in
Paris vollkommen handwerksmässig nament- lich durch die Hebammen und in
den Privat-Entbindungs- anstalten betrieben, deren wahrer Zweck
allgemein bekannt ist.“Ploss, Das Weib. I. Bd. S. 543 u. ff. Lombroso
spricht sich in seinem Buche „Das Weib als Verbrecherin und
Prostituirte“ ähnlich aus: „In den vereinigten Staaten ist der Abort
ein specifisches locales Gelegenheits-Verbrechen, das vor der
öffentlichen Meinung nicht mehr als strafbar gilt. … In diesem Lande,
wo die Frauen immer mehr an der Berufsarbeit und den Geschäften Theil
nehmen, wozu die Entwickelung des Capitalismus drängt, ist die
Mutterschaft oft ein sociales Übel, der Abort fast eine Nothwendigkeit;
die öffentliche Meinung richtet ihr Urtheil nach dieser Lage der
Dinge.“ Dass nicht Abnahme der natürlichen Fruchtbarkeit, sondern
absichtliche Verhütung der Empfängniss oder der regelmässigen Geburt
der überwiegende Grund der geringen Geburtenrate ist, darin stimmen
viele Beobachter überein. Ich erinnere an die schon früher angeführten
Worte von Dumont: „Die wahre Ursache des Herabgehens unserer (der
französischen) Geburtenziffer ist der Wille, nur wenig oder keine
Kinder zu haben,“ und von Comte: „Die Krankheit der Gesellschaft wird
als physisch angesehen, während sie ausschliesslich moralisch ist.“
Hier können wir also constatiren, dass die Armuth auch einmal einen
Vortheil im Kampf um’s Dasein mit sich bringt, dass sie in sich neben
so vielen ausmerzenden Momenten auch eines birgt, das ihre Opfer in der
Erzeugung der Nachkommenschaft schützen hilft. Dieser Schutz betrifft
jedoch nur die Zahl der Nach- kommen, keineswegs ihre Güte. Im
Gegentheil, die Kinder der Armen haben eine bedeutend grössere
Sterblichkeit als die der Wohlhabenden, und zwar fällt die
Kindersterblichkeit ganz regelmässig, wenn das Einkommen der Eltern
steigt. Einige Zahlenangaben mögen dies belegen. Nach A. Wolff’s
Untersuchungen über die Kinder-SterblichkeitCitirt in Oldendorff, A.
Die Säuglingssterblichkeit in ihrer socialen Bedeutung. Archiv für
sociale Gesetzgebung und Statistik. I. Jahrg. S. 89. beträgt in Erfurt
die Mortalität der Säuglinge im Arbeiterstande 30,5 %, im Mittelstande
17,3 %, in den höheren Ständen 8,9 %. In Braunschweig starben nach Reck
(Bericht über die Gesundheitsverhältnisse der Stadt Braunschweig)Citirt
in Wurm, Die Volksernährung, Dresden 1888. S. 199. Die noch folgenden
Angaben werden von UffelmannUffelmann. J., Handbuch d. Hygiene des
Kindes. Leipzig 1881. S. 93. citirt. Nach Clay leben von 100 lebend
Geborenen in England nach Verlauf von 10 Jahren: aus den vornehmen
Ständen noch 81 aus dem Handels-Stande „ 56 aus dem Arbeiter-Stande „
38 In dem wegen seiner musterhaften Arbeiterverhältnisse fälschlich
berühmt gewesenen Mühlhausen i. Els. sterben 50 % der Kinder der
Arbeiterclasse vor dem 8. Jahre, während 50 % der Kinder von
Fabrikanten das 29. Jahr erreichen. Nach dem Bericht des
Oberbürgermeisters Bachem starben in Köln von Eltern mit einem
Einkommen bis 600 Mark 29 % der Säuglinge von 600—1500 „ 25 „ „ „ von
1500—3000 „ 18 „ „ „ von über 3000 „ 15 „ „ „ Dass diese Erscheinung
auch für die reichsten Familien gilt, zeigte Casper: unter 1000
Sterbefällen in fürstlichen Familien trafen 57, von 1000 Sterbefällen
in armen Familien dagegen 345 auf Kinder bis zu 5 Jahren. Die
Vermögens-Verhältnisse der Eltern haben nicht nur einen Einfluss auf
die Sterblichkeit, sondern auch auf die Körperentwickelung der Kinder.
Kinder armer Eltern sind schlechter entwickelt. VillerméCitirt in Lux,
H. a. a. O. S. 105., ein hervorragen- der französischer Statistiker,
constatirt, dass „der Mensch um so grösser wird und sein Wachsthum um
so schneller seine Vollendung erreicht, je reicher unter im Übrigen
gleichen Umständen das Land, je allgemeiner der Wohl- stand ist, je
besser die Kleidung, die Wohnung, besonders aber die Nahrung, und je
geringer die Noth, die Anstren- gungen und Entbehrungen sind, die man
in der Kindheit erfährt.“ Geissler und Uhlitzsch (Die
Grössenverhältnisse der Schulkinder des Freiberger Bezirks 1888)
maassen unter einer Bevölkerung, in der sich der Bergmanns-Beruf
forterbt, 10343 Knaben und 10830 Mädchen, wobei sich ergab, dass die
Bergmanns-Kinder durchschnittlich um 2, 3 bis 5 Centimeter kleiner
waren als die Bürgerkinder. Die „Neue Zeit“ (XI. Jahrgang, 1. Band. No.
27) liefert ähnliche Belege durch folgende Ziffern der Professoren
Hasse in Leipzig, Bowditch in Boston und Pagliani in Turin. Die
Durchschnittsgrösse der Kinder betrug in Centimetern nach Hasse: nach
Bowditch: nach Pagliani: nach Geissler und Uhlitzsch: Ganz ähnliche
Unterschiede stellten diese Autoren für das Gewicht der Untersuchten,
Pagliani auch noch für die Lungencapacität fest, woraus hervorgeht,
dass das Überwiegen der Länge bei den Kindern der Wohlhabenden kein
ungesundes in die Höhe Schiessen ist, sondern ein durchaus gesundes
Wachsthum. Die obigen Ziffern be- ziehen sich auf Städte mit
beträchtlicher Industrie-Bevöl- kerung. Man könnte geneigt sein, diesem
Umstand die grössere Sterblichkeit der armen Kinder zuzuschreiben.
Vielleicht möchte es sich auf dem Lande anders verhalten. Es liegt mir
zwar keine direct verwendbare Angabe hier- über vor, allein die
Thatsache, dass die Durchschnitts- Sterblichkeit aller Kinder der
Landbewohner immer noch ziemlich viel höher ist als die der Kinder von
reichen Städtern, lässt darauf schliessen, dass auch auf dem Lande die
Kinder der Armen eine grössere Sterblichkeit haben als die der Reichen.
Der Unterschied ist nur nicht so be- deutend wie in den Städten, da die
Gesammt-Sterblichkeit der Kinder der Landbewohner ein gut Theil
geringer ist als die der Stadtkinder. Uffelmann Uffelmann. Hygiene des
Kindes. S. 87. sagt: „Schon Süssmilch berechnete, dass auf 100
Todesfälle im Alter von 0—5 Jahren kamen in Städten 46,4 auf dem Lande
38,2. Nach Oesterlen starben in sieben europäischen Staaten im Mittel
von 100 Geborenen (incl. Todtgeborenen) vor Ablauf des 5. Jahres in
Städten 33,60 % auf dem Lande 27,28 „. In England traten unter 100
Todesfällen aller Alters- classen ein bei Kindern bis zu 10 Jahren im
Mittel 44,91 % in Städten mit 100000 Einwohnern und mehr 51,39 „ „ „ „
weniger als 20000 Einwohnern 46,79 „ in feldbauenden Landdistricten
35,40 „ Ausnahmen sind selten.“ Mit diesen Ziffern über die
Kindersterblichkeit auf dem Lande vergleiche man die oben besprochene
Sterblichkeit der reichen Stadtkinder, und man wird den Unterschied zu
Gunsten der letzteren ziemlich gross finden. Wieviel von der
mangelhaften Körperentwickelung und grossen Sterblichkeit der Kinder
armer Leute auf ange- borene Schwäche und wieviel auf die späteren
Einflüsse der Armuth zu setzen ist, ist nicht zu bestimmen. Es wird der
grössten Wahrscheinlichkeit nach beides zusammen wirken, besonders in
den Gegenden, wo viel Frauenarbeit herrscht. Der ausjätende Charakter
der Armuth erhellt auch noch wenigstens zum Theil aus dem Vergleich der
körper- lichen Beschaffenheit von erwachsenen Armen und Reichen. Bebel
Die Frau und der Socialismus. XII. Aufl. Stuttgart 1892, S. 185.
erzählt folgende Beobachtung: „In unseren Industriebezirken bilden
Arbeiter und Unternehmer schon äusserlich einen solchen Gegensatz, als
gehörten sie zwei verschiedenen Menschenrassen an. Obgleich an diesen
Gegensatz gewöhnt, kam er uns doch in einer fast er- schreckenden Weise
anlässlich einer Wahlversammlung vor die Augen. … Den vorderen Theil
des Saales nahmen die Gegner ein, fast ohne Ausnahme starke, kräftige,
oft grosse Gestalten, von sehr gesundem Aussehen, im hinteren Theil des
Saales und auf den Galerien standen Arbeiter und Kleinbürger, zu
neunzehntel Weber, meist kleine, dünne, schmalbrüstige, bleichwangige
Gestalten, denen Kummer und Noth aus dem Gesichte sah.“ Bebel
beschuldigt die äusseren Lebensbedingungen ausschliesslich. Hiergegen
hat man aber den Unterschied in der Grösse und sonstigen Beschaffenheit
der Köpfe in’s Feld geführt. Wohlhabende scheinen durchschnittlich
grössere Köpfe zu haben, was auf grössere Gehirne nnd deshalb höhere
geistige Functionen zurückschliessen lässt. Ammon Ammon. a. a. O. S.
252 u. ff. maass in Karlsruhe die Köpfe von 30 Männern, die dem
wohlhabenden Stande angehörten und zum grössten Theil Gelehrte,
Techniker und Künstler waren. Unter diesen Köpfen fanden sich so viele
lange Köpfe über 19 cm, wie sonst in keiner anderen von ihm gemessenen
Gruppe. Kein einziger Kopf maass unter 18 cm Länge. Nach dem
Verhältniss der Wehrpflichtigen (25,2 % unter 18 cm Länge) müssten
unter der gemessenen Gruppe 8—9 Köpfe unter 18 cm haben. Doch bildet
hier die etwaige Übung und Auslese der Intelligenz einen Factor, der
den Vergleich stört. Nach den Messungen der Tarnowskaja Lombroso, C.
und Ferrero. Das Weib als Verbrecherin und Prostituirte. Deutsch von
Kurella. Hamburg 1894. S. 309 u. 312. war die berechnete
durchschnittliche Schädelcapacität bei 150 Pro- stituirten (also fast
ausschliesslich Armen) 1452 ccm, bei 100 Diebinnen (ebenfalls meist
Armen) 1462 ccm, bei 100 russischen Bäuerinnen 1465 ccm und bei 50
gebildeten Stadtfrauen, die wohl meist wohlhabend waren, 1467 ccm. Der
französische Anthropologe Le Bon Variations du volume du cerveau. Revue
d’Anthropol. Paris 1879. VIII. Jahrg. 2. Ser. 2. Theil. S. 27. maass
bei 1200 normalen Franzosen verschiedener Lebensstellungen den
Kopfumfang, ein Maass, das sowohl nach seinen wie Welcker’s
Untersuchungen bei grösserem Betrage der Fälle dem Hirngewicht
annähernd proportional ist, und fand in Procentzahlen einen Bei den
Bauern der Beauce, die Le Bon maass, war das Verhältniss noch
ungünstiger, die Kopfumfänge schwankten im Grossen und Ganzen zwischen
54 und 56 cm. Die Wissenschaftler könnten also nach obiger Tabelle den
Anspruch erheben, dass sie als Stand das grösste Geistes- organ
besitzen, dann folgen die Bürger, dann der Adel, schliesslich die
Bedienten und die Landbauern. Diese mageren Angaben — bessere habe ich
nicht auftreiben können — geben natürlich ganz und gar nicht einen
festen Anhalt für eine niedrigere Organisations-Stufe der Armen. Meine
Beobachtungen, die während der Aus- übung der ärztlichen Praxis zum
grössten Theil schätzungs- weise gemacht wurden, und deren exacter
Theil zu einer Veröffentlichung noch zu geringfügig ist, haben mich
aller- dings auch zu der Annahme gebracht, dass die Wohl- habenden im
Grossen und Ganzen wohl etwas grössere Köpfe haben. Allein solche und
ähnliche Schätzungen trügen zu sehr; genügend umfangreiches beweisendes
Material ist nicht vorhanden. Bär Bär, A. Der Verbrecher in
anthropologischer Beziehung. Leipzig 1893. S. 155. spricht sich ganz im
Allgemeinen dahin aus: „Erscheinungen degenerativer Natur finden sich
bei Indivi- duen aller Classen der menschlichen Gesellschaft, häufiger
aber in den niederen Schichten der Bevölkerung als Stigma der
Inferiorität ihrer Organisation“. Blaschko gesteht zu: „Es wäre
thöricht, läugnen zu wollen, dass oft ein gutes Theil angeborener
höherer geistiger Leistungsfähigkeit vorhanden ist (nämlich bei den
oberen Classen) und äusserlich sichtbar zu Tage tritt, wenn das auch
noch nicht in feste anthropologische und anato- mische Formeln zu
fassen ist“. Blaschko, A. Natürliche Auslese und Klassentheilung. Neue
Zeit, Stuttgart 1894/95. XIII. Jahrg. 1. Bd. S. 620. Überall würde
ausserdem die Frage eine Hauptrolle spielen (also auch bei der
Kopfgrösse), was von den Unter- schieden zwischen Armen und
Wohlhabenden ist nur der Anlage und was nur den äusseren Wirkungen auf
dieselbe zuzuschreiben. Die sichere Entscheidung dieser Frage im
Einzelfall wird meist unmöglich sein. Und was die Beurtheilung ganzer
Bevölkerungs-Schichten anlangt, so sind Männer wie Buckle und viele
Socialisten, die von Unterschieden der Anlagen bei Wohlhabenden und
Armen nichts wissen wollen, grade so sehr dem Vorwurf der Ein-
seitigkeit ausgesetzt, als diejenigen bürgerlichen Darwinianer, die
gegen die Wirkungen der Umgebung auf die Menschen im Lauf ihres
Individuallebens halb blind sind und alles auf Anlage zurückführen. Von
diesem Standpunkt aus müssen auch die ein- gehenden Untersuchungen
Ammon’s über die Verschiebung des hellen und dunklen Typus in
Deutschland betrachtet werden. Ammon, a. a. O. bes. Zusammenfassung S.
312 u. ff. Nach Ammon gehören die Wohlhabenden, wie über- haupt der
bessere Theil der Nation, mehr einem blonden, langköpfigen, den alten
Germanen ähnlichem Typus an, während die Armen, die im Kampf um’s
Dasein wenigstens in den Städten Unterliegenden, mehr einem kleineren
dunkleren, rundköpfigen Typus angehören. Folgende Aeusserung von Hölder
wird auch von Ammon S. 257 herangezogen: „Leicht kann sich Jedermann
überzeugen, dass im Allgemeinen die brachycephale (kurzköpfige)
Schädelform unter der niederen Volksklasse überall im Lande am
häufigsten vorkommt. Die besitzenden, höher stehenden Klassen, so
namentlich der ältere Adel, stehen dem unvermischten germanischen Typus
viel näher als jene.“ Im Alterthum und im Mittelalter hätten zahlreiche
Mischungen der beiden Typen stattgefunden. Nebenher sei auf der einen
Seite eine Auslese des hellen Typs gegangen, der die besseren geistigen
und Charakter-Anlagen hätte, allein auf der anderen Seite wäre durch
eine Reihe von Factoren eine so starke Schädigung dieses hellen Typs
erfolgt, dass er heut- zutage gegen früher in die Minderzahl gerathen
wäre und noch fortdauernd weiter abnähme. Diese Abnahme des hellen,
besseren Typs erfolge einerseits durch seine grössere Befähigung zum
Kriegsdienst, andererseits durch den folgenden Mechanismus. Die vom
Lande in die Städte Einwandernden begreifen in sich mehr helle
Langköpfe als die in dem ge- sunden Landleben Zurückbleibenden. In den
Städten nun hat der helle Langkopf es anfangs gut, er kommt rascher
fort als der dunkle Typ, so dass die Stadtgeschlechter um so mehr helle
Langschädel unter sich zählen, einer je späteren Generation sie
angehören. Nun sterben aber der Erfahrung nach die Geschlechter um so
rascher aus, je länger sie in der Stadt wohnen. Hierdurch wird das ger-
manische Element wieder zerstört, und da die vom Land in die Städte
Wandernden dem Lande relativ mehr helle Langköpfe entziehen als sie
zurücklassen, so wird durch diesen Process der Bestand der Nation an
hellen Lang- schädeln beständig vermindert. Ammon steht nicht an,
diesem Vorgang ein Nieder- gehen des deutschen Geistes in der letzten
Zeit zuzu- schreiben. Die ganze Beweisführung Ammon’s stützt sich auf
ein ziemlich grosses Beobachtungsmaterial. Allein ein wesent- licher
Punkt ist nicht genügend berücksichtigt, das ist der Einfluss der
geistigen Übung auf ihr Organ, das Gehirn. Wenn das Gehirn sich wie
andere Organe verhält, also bei starker Übung wächst, so ist es
möglich, dass bei der Stadtjugend in Folge der stärkeren geistigen An-
strengung ein Druck auf die in ihren Nähten noch nicht völlig
verwachsene Schädelkapsel ausgeübt wird. Ist dies der Fall, so wäre es
bei der verschiedenen Dicke der Schädelwand, einmal vorn und hinten,
das zweite Mal an 12 den Seiten, durchaus nicht so unwahrscheinlich —
oder unerhört, wie Ammon sagt, wohl im Bewusstsein des wunden Punktes —
dass der Schädel sich in verschiedener Weise in die Länge und in die
Quere ausdehnt, so dass das ursprüngliche Verhältniss dieser beiden
Maasse sich verschieben könnte. So lange dieser Punkt nicht durch
gründliche Untersuchungen klar gelegt worden ist, ist eine Verwerthung
des Theils der Ammon’schen Resultate, der besagt, dass die Armen einen
durchschnittlich niederern Typ repräsentirten, nicht zulässig. Vgl.
ausserdem die beachtenswerthen Einwürfe Blaschko’s a. a. O. Einen
anderen Einwand, der besonders gegen die Ausdehnung der Ammon’schen
Folgerungen auf ganz Deutschland spricht, liefert die Thatsache, dass
in Berlin eine Auslese des germanischen Typus, die Ammon für die Städte
behauptet, nicht vor sich geht. In Berlin waren 1875 nur 29,5 % der
Kinder von rein blondem Typus, d. h. hatten helle Haut, blonde Haare
und blaue Augen, in ganz Norddeutschland dagegen 33,5 bis 43,3 %.
Zeitschrift des Kgl. Preuss. statist. Bureaus. 33. Jahrg. Berlin 1893.
S. 197 ff. Man könnte meinen, dass vielleicht an dem Aufbau der
Berliner Bevölkerung die Einwanderung aus den polnischen Landestheilen
Preussens oder aus anderen, brünetten Gegenden stark betheiligt wäre,
so dass sich dadurch der geringe Procentsatz des blonden Typus erklären
würde. Diese Muthmassung findet aber in der Berliner Statistik keine
Begründung. Statist. Jahrbuch der Stadt Berlin. 1893. S. 20. Von
1876—1890 sind 936143 Fremde in Berlin ein- gewandert. Von dieser Summe
stammen 34426 aus Süd- deutschland und aus fremden Staaten mit Ausnahme
des stark blonden Skandinaviens, Englands, Hollands und der
amerikanischen Union, so dass wir diese Quelle von Brünettheit nur sehr
gering veranschlagen dürfen, um so mehr, als ja auch in Süddeutschland
und Oesterreich, die bei Weitem den grössten Theil dieser 34426 Fremden
ausmachen, beträchtliche Mengen blonder Elemente vor- handen sind. Von
der anderen, der grossen Hauptmasse der Fremden, 901717, stammten
895750, also mit geringer Ausnahme alle aus Norddeutschland. Von diesen
895750 Norddeutschen kamen aus Landestheilen mit muthmasslich wenig
germani- schem Typus, d. h. aus Posen, Schlesien, Ost- und West-
preussen und der Rheinprovinz 343267. Sehen wir uns nun diesen Theil
Norddeutschlands auf die Zahl seiner rein blonden Typen hier näher an,
so finden wir, dass unter je 100 Kindern rein blond waren in
Ostpreussen 39,6—39,9 Westpreussen 39,7—39,8 Posen 36,2 Mittel- und
Niederschlesien 30,1—31,3 Oberschlesien 27,3 Rheinprovinz (ohne Trier
und Aachen) 30,7—32,3 Rg.-Bezirke Trier und Aachen 24—25,9 Stadtkreis
Berlin 29,5. Von allen norddeutschen Quellen der Berliner Be- völkerung
weisen also nur Oberschlesien und der Südwesten der Rheinprovinz eine
geringere Zahl rein blonder Elemente auf als die Stadt Berlin. Die
Einwanderung von diesen kleinen Gebietstheilen fällt um so weniger in’s
Gewicht, als die Hauptmasse der einwandernden Fremden, 477270, die aus
den 4 Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen und Hannover stammen, das
Mittel Norddeutschlands in Bezug auf Blondheit weit überragen. Es waren
nämlich blond in Brandenburg 36,2—38,9 % Pommern 42,6 „ 12* Sachsen
36,2 % Hannover 41,0 „ Aehnliche Verhältnisse zeigen sich, wenn wir nun
auch den Antheil der Brünetten an der Bevölkerung Berlins mit dem an
der Bevölkerung der näheren und weiteren Um- gebung vergleichen. Die
rein Brünetten machten aus in Berlin 16,4 % Brandenburg mit Berlin 12,1
„ Norddeutschland 7—11,2 „ dem ganzen Deutschen Reich 14,1 „ Berlin hat
also mehr reine Brünette als sein Nährboden. Das sieht nicht nach einer
Einwanderung germanischer Elemente in die Stadt und ihrem Siege dort
aus. In dem Originalbericht Virchow, R. Gesammtbericht über die von der
deutschen anthropol. Ges. veranlassten Erhebungen über die Farbe der
Haut, Haare und Augen der Schulkinder in Deutschland. Arch. f. Anthrop.
Bd. XVI. 1886. S. 320. über diese Verhältnisse con- statirt Virchow:
„Ungemein zahlreich sind die grösseren und mittleren Städte, welche
eigene Verwaltungsbezirke besitzen, in denen die Verhältnisszahl der
Brünetten grösser ist als in den benachbarten ländlichen Bezirken ....
Grade die mehr sesshafte Bevölkerung des Landes und der kleinen Städte
ist die Trägerin der typischen Eigen- schaften, der brünetten so gut
wie der blonden“. Alle diese Thatsachen lassen die Verallgemeinerung
der Schlussfolgerungen Ammon’s nicht zu, dass die in die Städte
Einwandernden mehr germanische Elemente in sich schlössen, als die auf
dem Land Zurückbleibenden, und dass für den städtischen Kampf um’s
Dasein diese germanischen Elemente besser geeignet seien. Dass bei
unserem vorgebrachtem Einwand die Langköpfigkeit nicht direct
berücksichtigt ist, braucht ihn nicht abzustumpfen, da erstens
Langköpfigkeit bei dem rein blonden Typ öfter als beim braunen
vorkommt, und da zweitens nach Ranke die Langköpfigkeit keineswegs zu
den nothwendigen Eigen- schaften eines Germanen gehört, weil so rein
germanische Stämme wie die Friesen stark zur Kurzköpfigkeit neigen (12
% Lang-, 51 % Mittel- und 31 % Kurzköpfe). Dass die Armen durchgehends
die Schlechteren seien, behauptet natürlich auch Ammon nicht, da ja die
Bauernbevölkerung sowohl, wie die verhältnissmässig armen in die Städte
Eingewanderten auch diejenigen umfassen, die später die aufsteigenden
Stadtgeschlechter hervorbringen. Nach ihm schliessen also jedenfalls
die Armen ausser den bereits im Ausjäte-Process Begriffenen auch eine
grosse Menge der besten Convarianten in sich, und zwar grade
diejenigen, deren Abkömmlinge später in den Städten die geistige Elite
der Nation reprä- sentiren werden. Wie übrigens Ammon nach Darlegung
seines ver- meintlichen Processes der Verarmung der Nation an ihren
germanischen Elementen, für welch letztere er gradezu begeistert ist,
Sympathie für die wirthschaftlichen Formen aufbringen kann, die den
Process doch bedingen, ist mir unerfindlich. Nach unseren früheren
Darlegungen wäre der ganze Vorgang, falls er in Wirklichkeit existirte,
ein grossartiges contraselectorisches Phänomen, eine fortwährende Ver-
nichtung guter Convarianten, eine Schädigung unseres Volkes und der
Rasse, zu der wir gehören. Die wirth- schaftliche Ordnung, die diese
Contraselection gestattet, sollte mindestens nicht vertheidigt werden,
wie Ammon es in seiner Abhandlung über die Socialdemokratie thut. Aus
allen diesen Bemerkungen über die ökonomische Ausmerzung scheint es
somit keineswegs ohne Weiteres klar, dass die Reichen im Kampf um’s
Dasein, d. h. um Eigen- erhaltung und Nachwuchs über die Armen den Sieg
davon tragen, also in stärkerem Grade beim Aufbau der folgenden
Generation betheiligt sind. Die Reichen haben geringe Sterblichkeit,
aber auch wenig Geburten, die Armen haben grosse Sterblichkeit, aber
viel Geburten. Erst der relative Geburten-Überschuss in beiden Classen
würde uns zeigen, welche sich stärker vermehrt. Ziffern hierüber sind
schwer erhältlich. Soviel scheint festzustehen, dass sowohl die
reichsten Geschlechter wie die ärmsten Proletarier einer Entartung und
allmählichen Ausmerzung verfallen. Wie dagegen das Verhältniss sich
stellt nicht zwischen Reichsten und Ärmsten, sondern zwischen einer
wohlhabenderen und ärmeren Hälfte, das bleibt dahin- gestellt, schon
weil die heutige langsame Zerbröckelung des Mittelstandes durch
nonselectorische wirthschaftliche Factoren das Erkennen der
selectorischen Verschiebung verhüllt. Und doch wäre die Entscheidung
dieser Frage von so grosser Wichtigkeit für den Fall, dass die ärmeren
Classen durch- schnittlich ein schlechteres Menschenmaterial umfassten.
Darwin und Hiram Stanley neigen, wie aus den von mir weiter unten
angeführten Citaten hervorgeht, mehr zu der Annahme, dass durch die
starke Contraselection bei den Wohlhabenden die ärmere Hälfte es ist,
die die Continuität der Rasse hauptsächlich bewirkt. Auch ich kann mich
unter dem Eindruck vieler Thatsachen nicht erwehren, an den generativen
Ersatz unserer Cultur-Rassen durch ihre ärmere Hälfte zu glauben. Die
grösste Rolle spielt die ökonomische Ausmerzung jedenfalls innerhalb
der verschiedenen Gesell- schaftsclassen selbst, hauptsächlich bedingt
durch das zähe Festhalten der Menschen an der Stufe ihrer gewohnten
Lebenshaltung, das bei wirthschaftlicher Be- drängniss zur Vermeidung
der Ehe und zu Einschränkung der für die Gesundheit nothwendigen
Ausgaben zu Gunsten von Äusserlichkeiten tendirt. Werfen wir nun einen
Blick auf das Verhältniss der Armuth zum Rassenprocess zurück, so
erscheint als fest- stehend, dass ein Theil der Armuth die ökonomische
Ausjäte repräsentirt, dass aber auch ein sehr beträchtlicher Theil der
Armuth die Folge nonselectorischer Einwirkungen wie Krisen und anderer
Erscheinungen des capitalistischen Systems ist. Da dieser
nonselectorische Theil dieselben schlechten Folgen für die Gesundheit
der betroffenen Individuen und der von ihnen erzeugten Kinder hat, wie
der selectorische Theil der Armuth, so liegt im Gegensatz zu letzterem
sein bedeutender Schaden für den Rassen- process durch die bewirkte
Erzeugung vieler schlechten Devarianten auf der Hand. Das heutige
capitalistische System ist also durchaus nicht mit den reinen rassen-
hygienischen Forderungen in Übereinstimmung, wie uns so manche
Darwinianer glauben machen wollen. Fahren wir nun in dem Vergleich
unserer heutigen Zustände mit der rassenhygienischen Utopie fort. Wir
sind durch die Erwähnung der Ammon’schen Ausführungen auf die
Contraselection gekommen, und wollen diese weiter verfolgen.
Contraselection. Grosse Städte. Der bereits erwähnte Process, dass die
Städte die guten Convarianten aus dem Lande aufsaugen und sie in sich
vernichten, wird von vielen Beobachtern bestätigt. Die Städte sammeln
die Intelligenz und den Unternehmungs- geist des Landes zu grossartigen
Centren des geistigen Lebens, um jedoch allmählich die gesammelten
intelligenten Geschlechter durch grössere Sterblichkeit und nicht ent-
sprechende Zunahme der Geburten in sich zu zerreiben. Der bekannte
englische Statistiker Ogle schrieb 1889: „Idiotenthum und ebenso
Taubstummheit treten häufiger auf dem flachen Lande als unter der
Arbeiterbevölkerung der grossen Industriestädte auf. Ich kann diese
merk- würdige Thatsache nur damit erklären, dass die kräftigsten
Arbeiter des Landes jährlich in die Städte gehen und die schwächsten
übrigbleiben. Ist das aber der Fall, so muss man zu dem Schlusse
gelangen, dass die gesammte Be- völkerung Englands einer
fortschreitenden Verschlechterung unterliegt. Denn in den Städten ist
die Sterblichkeit stärker als auf dem Lande.“ In England betrug 1881
die städtische Bevölkerung 60 % der gesammten. Ein Bericht Lagneau’s in
der Pariser medizinischen Akademie constatirt (Bulletin médical, Juli
1890: „In Frank- reich rechnet man 1888 21,9 Todesfälle auf 1000 Ein-
wohner überhaupt, 20,8 auf 1000 Landbewohner und 24,5 auf 1000
Einwohner des Département de la Seine (Paris und Umgebung) ..... Die
Sterblichkeit der Einwohner der grossen Städte, insbesondere von Paris,
wenn man die- jenige der auf’s Land geschickten Säuglinge hinzurechnet,
würde mehr oder minder prompt das Erlöschen der städtischen Bevölkerung
herbeiführen, wenn sie nicht unauf- hörlich durch eine Einwanderung von
Provinzialen und Fremden erneuert würde. Diese Erneuerung ist während
jeder Generation von ca. 33 Jahren so umfangreich, dass in Paris bei
der Zählung von 1886 von 1000 Einwohnern nur 331 in Paris geboren,
dagegen 669, also mehr als zwei Drittel, eingewandert waren.“ In den
sogenannten Registrations-Staaten der amerika- nischen Union, in denen
die Sterbefälle in ziemlich zuver- lässiger Weise registrirt werden,
betrug die Sterblichkeit in der Gesammtheit der Städte 23,58 ‰, in der
der länd- lichen Gemeinden nur 15,5 ‰; sie war also in den Städten um
die Hälfte grösser. Compendium of the 11 Census. Part II. Washington
1894. S. 4. Für Berlin können wir den wirklichen Sterblichkeits-
verhältnissen, die durch das starke Einwandern der kräftigsten
Altersclassen noch viel günstiger scheinen, als sie in Wahr- heit sind,
bedeutend näher kommen, wenn wir die von Böckh wissenschaftlich
berechnete corrigirte, d h. die aus der Sterblichkeitstafel abgeleitete
Sterblichkeitsziffer in Be- tracht ziehen. Statist. Jahrbuch der Stadt
Berlin. 1893. S. 47. Dann ergeben sich folgende Sterberaten in
Promillen für das Deutsche Reich (gewöhnliche Sterbe- rate) und Berlin:
Diese Gegenüberstellung — die corrigirte Sterbeziffer des Reichs würde
nur wenig von seiner gewöhnlichen Sterberate abweichen — bringt
natürlich auch schon deshalb nicht den ganzen Unterschied der
städtischen und länd- lichen Mortalität zum Ausdruck, weil die
Sterblichkeiten aller Städte, auch Berlins, in der
Gesammt-Sterblichkeit des Deutschen Reichs enthalten sind, und also die
ländlichen Gemeinden allein eine noch bedeutend geringere Sterblich-
keit als die des ganzen Reichs haben müssen. Aehnliches gilt für die
Geburten. Die Rate derselben ist bei der Gesammtbevölkerung der Stadt,
die aus Stadt- geborenen und Eingewanderten besteht, höher als bei den
Stadtgeborenen allein, weil unter den zahlreichen Ein- wanderern
relativ mehr junge und kräftige sind, als unter den Stadtgeborenen.
Trotz dieses günstigen Momentes ist die Geburtenziffer der gesammten
Stadtbevölkerung häufig noch geringer als die des Landes. In Frankreich
fielen 1888 im Seine-Département (Paris und Umgebung) auf 100 Frauen
zwischen 15—45 Jahren 10 Geburten, in allen übrigen Départements 12—13.
Für das Deutsche Reich und Berlin betrugen die Ge- burtenraten auf 1000
Einwohner im Jahr Reich Berlin 1882 38,8 39,4 1883 38,2 37,9 1884 38,7
37,1 1885 38,5 36,4 1886 38,5 35,6 1887 38,4 35,2 Jahr Reich Berlin
1888 38,1 34,5 1889 37,9 34,0 1890 37,0 32,8 1891 38,2 33,4 1892 36,9
31,7 Der zum Theil beträchtliche Geburten-Überschuss der grösseren
Städte — nur Oberitalien und Frankreich weisen solche mit Überschuss
von Sterbefällen auf — kann nicht gegen den lebensfeindlichen Einfluss
der Stadt heran- gezogen werden, da, wie wir schon erwähnten, die
starke Einwanderung kräftiger junger Leute vom Lande einerseits die
Sterblichkeit der eigentlichen Städter geringer, andrer- seits ihre
Geburtenziffer höher erscheinen lässt. Die Schädigung der Culturrassen
durch die Städte ist überdies noch in stetem Zunehmen begriffen, da der
An- theil der städtischen an der Gesammtbevölkerung fort- während
steigt. In Frankreich kamen 1872 31 % auf die Städte, 1886 dagegen 36
%; Belgien hatte bereits 1856 nur 25 % acker- bautreibende Bevölkerung,
1880 nur noch 22 %. Im Deutschen Reich stieg der Procentsatz der Stadt-
bevölkerung von 36,1 im Jahre 1871 auf 42,8 im Jahre 1890. Dabei sind
als Städte alle Orte von 2000 und mehr Ein- wohnern betrachtet worden.
In den Vereinigten Staaten von Amerika wohnten im Jahre 1800 nur 4 %
der Bevölkerung in Städten, im Jahre 1840 schon 8,5 %, im Jahre 1880
dagegen 22,57 % und im Jahre 1890 29,12 %. Im Staate Connecticut, einem
der entwickeltsten der Union, stieg die städtische Bevölkerung von 20 %
im Jahre 1850 auf 53 % im Jahre 1890. Dieser allgemeine Zug in die
Stadt bei allen Cultur- nationen bildet eine fortwährende Steigerung
des ohnehin schon grossen Betrages der Contraselection. Die anderen
Elemente der Contraselection haben wir bereits früher besprochen.
Volkskriege und Revolutionen sind in unserer modernen Zeit häufig genug
gewesen und drohen für die Zukunft in denselben schlimmen Formen wieder
zu erscheinen. Auch die Geburten-Praevention ist in ihrer contra-
selectorischen Wirkung schon an mehreren Stellen ge- würdigt worden.
Für sie trifft dasselbe zu wie für die Städte: sie wächst mit der
Cultur. In Deutschland breitet sie sich neuerdings ebenfalls mehr und
mehr aus, und wenn sie auch noch den kleinen Mittel- und den niederen
Stand verschont hat, so hat sie doch bei unseren gebildeten Ständen
schon vielfach feste Wurzeln gefasst. Die Formen der Contraselection,
die einen besonders grossen Schutz grade der Schwachen bedeuten,
herrschen bei uns bereits in ausgedehntem Maasse. Hierher gehört vor
allem jede Pflege von Krankheiten, die unmittelbar auf dem Boden einer
anerzeugten Schwäche oder Anomalie erwachsen sind, wie z. B. viele
Geisteskrankheiten, viele Fälle von Schwindsucht bei Wohlhabenden; oder
die mittelbar durch anerzeugte Minderwerthigkeiten in ihrem Auftreten
erleichtert werden, wie z. B. viele Krankheiten, besonders
Schwindsucht, bei auf selectorische Weise arm Gewordenen. Die Ärzte
unter meinen Lesern werden sofort inne werden, ein wie bedeutender
Theil der medizinischen Thätigkeit der Contraselection dient. Andere
sociale Hülfseinrichtungen, die man versucht wäre hierher zu rechnen,
bedeuten zwar noch keine Contra- selection, aber doch schon eine
schädliche Aufhebung des Kampfes um’s Dasein in Bezug auf mancherlei,
meist wirth- schaftliche Fähigkeiten. Kranken-, Alters-, Unfall- und
Arbeitslosen-Versicherung, der ganze sogenannte Schutz der
wirthschaftlich Schwachen, sind in stets wachsender Organisation
begriffen und verfolgen bewusst den Zweck, den Kampf um’s Dasein
einzuschränken. Noch nicht erwähnte nonselectorische Schäden. Unfälle.
Trinksitten. Die grobe Zeichnung des heutigen Rassenprocesses darf der
Linien nicht entbehren, die sich auf die nonselec- torischen
Schädlichkeiten beziehen, d. h. auf solche, die nach dem jetzigen
Stande unseres Wissens Jeden ohne Rücksicht auf den Grad seiner
Constitutionskraft treffen und schädigen können. Dass ein bedeutender
Theil der Armuth hierher gehört, ist oben schon erwähnt worden. Ferner
gehört hierher der Theil der Unfälle, von dem die Geschädigten
betroffen wurden, ohne daran schuld und ohne durch die Art ihrer
Constitutionskraft der Gelegenheit zu dem Unfall besonders ausgesetzt
gewesen zu sein. Diesen Theil abzugrenzen, ist natürlich sehr schwierig
und in vielen Fällen unmöglich; ein selectorisches Element spielt doch
sehr häufig in stärkerem oder geringerem Grade mit. Wenn ein
unbeaufsichtigter Junge an einem Fenster mit einem geladenen Revolver
spielt, ihn abdrückt und einen zufällig Vorbeigehenden tödtlich trifft,
so ist das ein Beispiel rein nonselectorischer Vernichtung. Ein anderes
reines Beispiel bieten die mehreren Tausend Be- wohner von Ischia, die
vor einigen Jahren bei einem Erd- beben zu Grunde gingen. Wenn ein
Weichensteller beim Wagenkoppeln zwischen zwei Puffern zerquetscht
wird, so können hier schon eine ganze Menge selectorischer Momente
mitspielen. Der Mann konnte unter Alkoholwirkung gestanden haben,
konnte kränklich sein, konnte eine angeborene Langsamkeit der
Auffassung und Bewegung haben; vor allem konnte er aus selectorischen
Gründen arm geworden sein, so dass er sich dadurch überhaupt erst um
einen so gefährlichen Posten bewerben musste, u. s. w. Alle diese
Momente ent- halten etwas Selectorisches. Andrerseits konnte er durch
Überanstrengung im Dienst müde und unaufmerksam ge- worden sein; dann
gebührte der grösste Antheil an dem Unfall einem nonselectorischen
Factor, nämlich dem Aus- beutungs-Bestreben der Bahnverwaltung. Unfälle
und ähnliche z. Th. nicht wählende Schädlich- keiten sind nun zwar
keineswegs so selten wie man gemein- hin glaubt. So starben in den
Jahren 1890—92 in unseren Städten mit über 15000 Einwohnern etwa 15 ‰
aller Ge- storbenen durch Verunglückung und Todtschlag, ungefähr ebenso
viel wie an Unterleibstyphus und Scharlach zu- sammengenommen. Statist.
Jahrbuch f. das Deutsche Reich. 15. Jahrg. Berlin 1894. S. 147. Allein
das bildet noch keine besonders grosse Belastung für den Rassenprocess.
Dies kann man aber nicht so ohne Weiteres von einer anderen, höchst
wahrscheinlich zum grössten Theil nonselectorischen Schädlichkeit, von
unseren Trinksitten, behaupten. Es ist eine der schwierigsten und doch
der Lösung dringend bedürftige Frage, ob der unmässige Alkoholgenuss
bei den Culturvölkern, besonders den nörd- lichen, ein überwiegend
selectorischer Factor ist, der genügend Individuen so intact lässt,
dass die Continuität des gesunden Rassenprocesses gewahrt bleibt, oder
ob er überwiegend eine nonselectorische Schädlichkeit darstellt, die
Jeden ohne Rücksicht auf seine Kraft treffen und beeinträchtigen kann,
und dabei so viele wirklich trifft, dass durch die gleichzeitige
Verschlechterung der Zeugungs- producte die Rasse ernstlich bedroht
wird. Wäre es richtig, dass hauptsächlich sittlich schwache Personen
dem Alkoholismus zum Opfer fallen, sittlich widerstandskräftige,
besonnene Naturen aber bis auf Aus- nahmen verschont blieben, dann
würde der Rassen- hygieniker sans phrase keinen Grund haben, sich für
die nordische Temperenzbewegung zu erwärmen, die ja nur die Ausjätung
der Schwachen hindern würde. Träfe dagegen der Alkoholismus seine Opfer
ohne Rücksicht auf ihre Eigenschaften, sagen wir durch zu- fälliges
Bekanntwerden mit der Trinksitte, und schädigte er sie ausnahmslos in
einem gewissen Grade gleich stark (wenn auch in höheren Graden ungleich
stark), so wäre es zweifellos, dass unsere heutigen Trinksitten bei
ihrer enormen Ausbreitung und der ihnen folgenden Degeneration der
Nachkommen eine nonselectorische Schädlichkeit darstellen würden, die
der Rassenhygieniker mit allen Kräften be- kämpfen müsste. Die
Entscheidung dieser Frage wird selbstverständlich nicht in der Weise
erwartet, dass der ganze Alkoholismus nun entweder in den
selectorischen oder den nonselectorischen Topf geworfen werden muss,
sondern es handelt sich um das gegenseitige Grössen- verhältniss dieser
beiden Momente. In England, Nordamerika, Skandinavien und jüngst in der
Schweiz ist man in weiteren Kreisen zu der Über- zeugung gelangt, dass
der Alkoholismus eine die Gesammt- rasse degenerirende Volkskrankheit
ist, aber ein wirklicher Beweis ist nur dafür erbracht, dass ein
gewisser Theil des Volkes, jedenfalls mehr wie ein Zehntel, stark
geschädigt wird. Ob dadurch schon eine thatsächliche, wenn auch noch so
leichte, durchgehende Entartung des Volkes zu Stande gebracht wird,
bleibt zweifelhaft. Sicher jedoch ist, dass die Verhältnisszahl der er-
zeugten guten Devarianten durch die deletären Wirkungen des nicht sehr
mässig genossenen Alkohols (in Bier, Wein und Schnaps) auf die
Zeugungstoffe ganz beträcht- lich herabgedrückt wird. Schriebe ich für
ein gebildetes englisches Publikum, so brauchte ich hierfür nicht so
noth- wendig weitere Belege anzubringen. Aber unser gebildeter
Deutscher ist grade puncto Alkohol so schlecht unterrichtet und hegt so
merkwürdige Anschauungen über die zuträg- lichen Folgen seiner
Trinksitten, dass er ihre Schäden gar nicht sieht. Für ihn giebt’s noch
keine Alkoholfrage, wenn sie auch in anderen Ländern schon brennend ge-
worden ist. Und doch werden jährlich in die allgemeinen Heil- und
Irrenanstalten des Deutschen Reichs über 10000 Patienten mit Alcolismus
chronicus eingeliefert,Baer, A. Die Trunksucht und ihre Abwehr. Wien
und Leipzig 1890. S. 29. eine Zahl, die ja nur einen kleinen Theil des
Schadens anzeigt. Nach den Publicationen des Eidgenössischen
statistischen Bureaus, basirend auf ärztlichen Todtenscheinen aus den
15 grössten Städten der Schweiz während des Jahres 1891, fielen von den
1239 im Alter von 40—59 Jahren verstorbenen Männern 183 oder 14,8 % den
directen oder indirecten Folgen des Alkoholgenusses zum Opfer, d. h.
mehr als der siebente Theil. Dies repräsentirt nur die Sterblichkeit
durch die Trinksitten. Wieviel schwächliche Kinder diese Alkoholisten
vor ihrem Tode in die Welt gesetzt haben, das constatiren keine
Berichte. Demme, der Berner Kinderkliniker, hat den schlimmen Effect
der elterlichen Trunksucht in einigen Fällen genauer untersucht und ist
dabei zu erschreckenden Resultaten gekommen.Demme, Über den Einfluss
des Alkohols auf den Organismus des Kindes. Stuttgart 1891. S. 38. Er
verfolgte je zehn Familien von Trinkern und von sehr Mässigen in ihren
Lebensschicksalen. Von den 57 Kindern aus den Trinkerfamilien starben
an Lebensschwäche 25 = 43,9 % waren Idioten 6 = 10,5 „ zurückgeblieben
im Wachsthum 5 = 8,8 „ Epileptiker 5 = 8,8 „ hatten Veitstanz mit
Idiotie 1 = 1,7 „ angeborene Erkrankungen und Defecte 5 = 8,8 „
zusammen abnormale Kinder 47 = 82,5 % normal scheinende „ 10 = 17,5 „
Von den 61 Kindern aus den Familien Mässiger starben an Lebensschwäche
5 = 8,2 % hatten heilbare Nervenkrankheiten 4 = 6,6 „ angeborene
Defecte 2 = 3,3 „ zusammen abnormale Kinder 11 = 18,1 % normal
scheinende „ 50 = 81,9 „ Für die besonders Trinkfreudigen möge noch
folgende Angabe Neisson’s, eines englischen Gelehrten, Platz
finden.Citirt in Pflüger, Über die Kunst der Verlängerung des
menschlichen Lebens. Bonn 1890. S. 19. Er untersuchte 6111 Trinker im
Alter von 16—90 Jahren auf ihre wahrscheinliche Lebensdauer und
berechnete dieselbe Diese Ergebnisse sind von mehreren Seiten bestätigt
worden. Daraus wird verständlich, warum englische Lebens-
versicherungen Abstinenten billiger als Mässige versichern. Zu diesen
Gesundheits-Schädigungen kommt noch hinzu, dass das Trinken eines der
wirksamsten Mittel ist, die Gefängnisse und Irrenhäuser zu füllen,
sowie die an- steckenden Geschlechtskrankheiten zu verbreiten. Ich kann
aus Raummangel hierfür und für alle sonstigen Beziehungen zwischen der
Tüchtigkeit unserer Rasse und den Alkoholsitten nicht noch mehr von dem
in Masse vorhandenen Material beibringen. Das Angeführte genügt, um auf
die Stärke dieser Beziehungen hinzuweisen und den, der sich dafür
interessirt, zu weiterer Orientierung anzuspornen.Vgl. ausser Baer und
Demme, a. a. O. noch: Baer, A. Der Alkoholismus. Berlin 1878. — Bunge,
G. Die Alkoholfrage II. Aufl. Leipzig 1887 und Lehrbuch der
physiologischen und patho- logischen Chemie. II. Aufl. Leipzig 1890. —
Forel, A. Alkohol und Geistesstörungen. Basel 1891. — Gaule, J. Wie
wirkt der Alkohol auf den Menschen? Basel 1892. — Lang, O. Alkohol-
genuss und Verbrechen. Leipzig 1892. — Strümpell, A. Die Zwei andere
grosse Volksgeisseln, die Tuberculose und die Syphilis, sind in Bezug
auf ihre Bedeutung für den Rassenprocess und besonders in Bezug auf die
Frage, wie- viel nonselectorische Wirkungen sie entfalten, noch viel
weniger geklärt. Die Rolle, die eine etwaige Disposition bei der
Erkrankung an diesen beiden weitverbreiteten Uebeln spielt, wird von
den Wissenschaftlern für sehr verschieden wichtig gehalten. Die einen
schätzen sie sehr gering, die andern lassen kaum etwas ausser ihr
gelten, ja degradiren die Ansiedelungen der betreffenden Bakterien zu
einer neben- sächlichen Folge-Erscheinung. Deshalb muss noch eine
grössere ätiologische Klärung abgewartet werden, ehe wir die wahre
Bedeutung der beiden Krankheiten für den Rassen- process feststellen
können. Kurze Gegenüberstellung der beiden Processe. Im Grossen und
Ganzen ist nach den bisherigen Aus- führungen dieses Capitels das
Resultat unseres Vergleichs 13 des heutigen Standes der
Entwickelungsfactoren mit dem, wie er von einer rücksichtslosen
Rassenhygiene gefordert werden müsste, durchaus kein so günstiges, dass
wir uns jeder Befürchtung für die Zukunft unserer Rasse entschlagen
dürften. Schlechtere Devarianten werden in Masse gezeugt, trotzdem sie
zum grossen Theil vermeidbar wären. Dem Kampf um’s Dasein sind vielfach
Schranken gezogen, und die Contraselection wächst in höchst
bedrohlichem Maasse. Was das Verschlechtern der Devarianten anlangt, so
ist als eine der Hauptursachen desselben in neuerer Zeit der grosse
Betrag nonselectorischer Armuth zu nennen, den die hohe Entwickelung
des Capitalismus mit sich ge- bracht hat. Eine fernere Ursache ist das
Anwachsen des nonselectorischen Theiles des Alkoholismus. Neben diesen
mehr modernen Ursachen spielen natürlich die alten, die hauptsächlich
aus dem ungeregelten Ablauf der Fort- pflanzungsfunctionen
hervorgingen, immer noch ihre frühere Rolle. Allerdings sind auch
manche Quellen der Ver- schlechterung der Devarianten, die aus
nonselectorischen Schädlichkeiten entsprangen, durch die moderne
Hygiene verstopft worden. Was die Beschränkung des Kampfes um’s Dasein
und das Anwachsen der Contraselection anlangt, so erscheinen diese
beiden Momente hauptsächlich als Gefolge des Sieges- zuges, den der
humanitäre Gleichberechtigungs-Gedanke durch unsere moderne Culturwelt
angetreten hat. Huxley nennt die Einschränkung des Kampfes um’s Dasein
geradezu das Wesen der Civilisation. Alkoholfrage vom ärztlichen
Standpunkte aus. Berliner klinische Wochenschrift 1893. No. 39. — Zur
Alkoholfrage, Vergleichende Darstellung der Gesetze und Erfahrungen
einiger ausländ. Staaten zusammengestellt vom Eidgenöss. statist.
Bureau. Bern 1884. Da der Capitalismus, diese eine Ursache der
Devarianten- Verschlechterung, die unzweifelhafte Tendenz hat, auf der
Höhe seiner Entwickelung in mehr socialistische Productions- weisen
überzugehen,Vgl. Marx, K. Das Kapital. Kritik der politischen
Oekonomie. I. Band. III. Aufl. Hamburg 1883 und Engels, Fr. Eugen
Dühring’s Umwälzung der Wissenschaft. III. Aufl. so bleibt nur noch der
Gegensatz ernstlich zu betrachten, der zwischen den Gerechtigkeits- und
den humanen Idealen auf der einen Seite und der Nothwendigkeit der
Rassen-Vervollkommnung auf der an- deren Seite besteht. Der näheren
Untersuchung dieses Gegensatzes wollen wir ein neues Capitel widmen.
13* 5. Capitel. Der Conflict zwischen Rassen- und Individual- Hygiene
und seine Lösung. Die nonselectorischen socialpolitischen Systeme. Ihre
elementaren Forderungen: der angepassten Summen der Bevölkerung und der
Productionsmittel, des gleichen Nutzrechtes der Productionsmittel und
der Versicherung gegen Arbeitsunfähigkeit. Die Beziehungen dieser drei
Postulate zur Erhaltung und Fortpflanzung der Individuen. Socialismus
und Malthusianismus. — Conflict mit den Forderungen der Rassenhygiene.
Angriffe bedeutender Darwinianer auf die non- selectorischen Systeme. —
Deren Vertheidiger und ihre Versuche zur Lösung des Conflicts.
Wallace’s Lösung durch Verstärkung der sexuellen Auslese. — Lösung
durch Beherrschung der Variabilität. Beeinflussung und künstliche
Auslese der Keime. Einwürfe. Die modifizirten Rassenforderungen.
Nothwendigkeit, schon heute Kenntnisse zu verbreiten, die die Erzeugung
tüchtiger Nachkommen betreffen. Der Socialismus vom rassenhygienischen
Standpunkt. Die nonselectorischen Forderungen der Socialpolitik und der
Individual-Hygiene. Im vorigen Capitel sprachen wir bereits aus, dass
das demokratisch-humanitäre Ideal es ist, welches sich den reinen
Rassenforderungen in immer wachsendem Maasse entgegensetzt. Es gehört
keine grosse Phantasie dazu, sich auszumalen, wieviel Unterdrückung und
Jammer mit der Durchführung dieser Forderungen verknüpft sein würden;
die Menschheit würde ewig auf Kosten der Gegenwart mit Schmerzen für
die Zukunft sorgen. Auch die heutige abgemilderte Form des Kampfes um’s
Dasein bringt noch eine so grosse Masse Elend mit sich, dass bei der
steigenden Verfeinerung unserer Empfindung die Motive des Mitleids und
der Humanität immer neue Anreize erhalten. Viele, die ein Interesse an
der Aufrechterhaltung der heutigen Privilegien haben, suchen ja das
Elend zu ver- tuschen, allein man braucht, um es voll zu erkennen, kein
nationaloekonomisches Sonntagskind zu sein, wie Karl Marx, oder ein
hellsehender Dichter, wie Gerhart Hauptmann; es genügt, ein ruhiger,
menschlicher Betrachter menschlicher Dinge zu sein, der sich nicht
weiss machen lässt, was schwarz ist. Die Thatsache des Elends eines
grossen Theils der Menschheit hat seit den ältesten Zeiten die
Unzufriedenen zu theoretischen Forderungen und blutigen Versuchen zur
Abhülfe getrieben. Diese Forderungen zeigen von der einzelnen
Maassregel theoretisch kurzsichtiger Politiker bis zu den
ausgearbeiteten Systemen praktisch kurzsichtiger Utopisten alle
möglichen Abstufungen. Auch die heutigen socialpolitischen Bestrebungen
gehen von den verschiedensten Gesichtspunkten aus. Die Systeme des
reinen Manchesterthums und theil- weise die mehr und weniger verwandten
Systeme der resignirten Concurrenzwirthschaftler kommen mit dem Princip
der natürlichen Zuchtwahl wenig in Conflict. Sie wären nur werth, dass
man ihnen näher auf die Finger sieht in Bezug auf ihre Tendenz, durch
Schaffung nonse- lectorischer Armuth die Devarianten zu verschlechtern.
Theilweise ist dies im vorigen Capitel geschehen. So nothwendig eine
eingehendere Betrachtung wäre, würde sie uns doch hier zu weit
abführen, weil eine weitere Aus- breitung der Principien dieser Systeme
nach den Arbeiten von Marx und verschiedenen Katheder-Socialisten weder
wissenschaftlich wahrscheinlich ist, noch auch in der Richtung der
gewaltig anwachsenden humanitären Cultur- bewegung liegt. Diese
letztere scheint durch Aufhebung des Kampfes um’s Dasein eine viel
grössere Gefahr für die Tüchtigkeit unserer Rasse einzuschiessen. Wir
haben deshalb unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen Systeme zu
concentriren, deren beabsichtigte oder unbeabsichtigte Wirkungen eine
Einschränkung oder völlige Abschaffung des Kampfes um’s Dasein
hervorrufen würden. Hierher muss man die mal- thusianischen, alle
socialistischen, seien sie staatssocialistisch, christlich-social oder
socialdemokratisch, sowie die gemischten Systeme rechnen, soweit deren
Versicherungs- und sonstige Schutzmaassregeln in den natürlichen Gang
des Wettbewerbs eingreifen. Es würde zu weit führen, alle diese
Systeme, die ich der Bequemlichkeit halber nonselectorische nennen
will, genauer vorzuführen. Es sollen hier nur ihre Elementarforderungen
oder -Erwartungen formulirt werden, um zu untersuchen, wie weit nnd
unter welchen Bedingungen ihre Erfüllung mit der Fortdauer einer
gedeihlichen Ent- wickelung der Rasse verträglich ist. Die sonstige
Durch- führbarkeit oder Berechtigung dieser Elementar-Forderungen soll
natürlich gänzlich ausser Acht gelassen bleiben. Das Grundbestreben
aller Unterdrückten und im Kampf um’s Dasein Herabgekommenen ist, ihre
Lebensbedingungen so zu verbessern, dass sie Lust und Unlust in
demselben günstigen Verhältniss empfinden, wie sie es bei den
Privilegirten voraussetzen. In den Zeiten der rechtlichen Abhängigkeit
einzelner Stände war es die einfache Forderung der gleichen Freiheit
Aller, der gleichen Entfaltungs-Mög- lichkeit der Persönlichkeit, von
deren Erfüllung man er- wartete, dass nun auch die Befreiten wirklich
ihre Fähig- keiten entfalten und ihre Lage bedeutend verbessern würden.
Aber man sah bald, dass nach wie vor ein grosser Theil des Volkes in
Elend weiterlebte, weil ihm die materiellen Grundlagen der Verbesserung
der Lage fehlten. Man fand diese Grundlagen in der Arbeits-Fähigkeit
des Individuums nnd in der Zugänglichkeit der Natur (ein- schliesslich
aller Productionsmittel) als Object und Werkzeug für die Arbeit und
erstreckte die Gleichberechtigungs- Forderungen nun auch darauf.
Menschliche Arbeit und Natur, auf welche sie angewandt wird, bilden die
Quelle aller Bedürfniss-Befriedigung und aller Güter. Auch in dem Fall,
wo ein Mensch sich scheinbar ohne Arbeit und Natur Befriedigung
verschafft, z. B. beim Verharren in Musse oder Schlaf, braucht er die
Güter dazu, die nöthig sind, um den körperlichen Stoff- verbrauch
während der Zeit zu decken. Die Ursachen des Unterschieds in der
Bedürfniss-Befriedigung der Menschen können also nur darin liegen, dass
die Natur, einschliesslich aller Productionsmittel, nicht Jedem
gleichmässig zugänglich ist, oder dass die aufgewendete Arbeitskraft
verschieden ist, oder dass ein Theil der Menschen von dem anderen
nimmt, ohne etwas Gleichwerthiges zu geben. Alle drei Ursachen bestehen
in ausgedehntem Maasse noch in der heutigen Gesellschaft. Dem Erben
eines Ritter- guts oder einer Fabrik sind die Productionsmittel zugäng-
licher wie dem Sohn eines Proletariers. Ein Schwacher, eine Schwangere,
ein Kranker können nicht die Durch- schnitts-Arbeitskraft aufbringen.
Die Aneignung der Arbeits- resultate Anderer findet im weitesten Maasse
statt als nothwendige Folge der heutigen Wirthschaftsform, die den
Waaren-Charakter der Arbeitskraft und damit das Auftreten des
annectirbaren „Mehrwerths“ bedingt.Marx, Karl. Das Kapital. Hamburg
1883. I. Bd. 2. und 3. Abschnitt. Wie ist dem zu steuern? Wie ist jedem
Menschen die gleiche Möglichkeit der Befriedigung seiner Bedürfnisse,
der Entfaltung seines Wesens zu verschaffen? Versuchen wir einmal, im
Geiste der nonselectorischen Systeme zu deduciren. Gegeben sei eine
menschliche Ge- sellschaft und das Stück Erde, auf dem sie lebt. Soll
Allen die gleiche individuelle Entfaltung gewährleistet werden, so ist
die erste Forderung die, dass die Gesammtheit der verfügbaren Natur
(einschliesslich der von den früheren Generationen geschaffenen
Productionsmittel) zur Gesammt- heit der Menschen in ein solches
Verhältniss gebracht wird, dass Jeder — bei gleicher Zugänglichkeit der
Natur — mit Durchschnitts-Arbeitskraft mindestens die nothwendigen
Bedürfnisse des individuellen und Gattung- lebens befriedigen kann.
Diese Forderung werde ich die der angepassten Summen der Bevölkerung
und der Productionsmittel oder kurweg die Forderung der angepassten
Summen nennen. Als zweite allgemeine Forderung muss die Bedingung
erfüllt werden, dass der Grad der Benutzbarkeit der Natur, überhaupt
aller Productionsmittel, für Alle der gleiche ist. Diese Forderung
werde ich die des gleichen Nutz- rechtes der Productionsmittel oder
kurz die des gleichen Nutzrechtes nennen. Die Factoren Rohstoff und
Werkzeug der Arbeit für die Befriedigung der Bedürfnisse wären nun in
gleichem und ausreichendem Maasse gesichert. Allein das genügt noch
nicht. Wer keine oder nur eine schwache Arbeitskraft besitzt, könnte
doch noch verhungern, wenn nicht das Postulat erfüllt würde, die
Arbeitsproductivität zum Theil oder ganz versagender Arbeitskraft
Einzelner auf die durch- schnittliche Arbeitsproductivität Aller zu
ergänzen. Dadurch würde z. B. einem 60jährigen nur halb arbeitsfähigen
Mann, einer schwangeren Frau, einem geschwächten Kranken, sowie den
Kindern die volle Befriedigung der nothwendigen Bedürfnisse garantirt.
Dies werde ich die Versicherungs- Forderung nennen. Diese drei
Elementar-Forderungen der nonselectorischen Systeme zielen hin auf die
Entfaltungsmöglichkeit aller Individuen, der schwachen wie der starken,
sie müssen sich also in allen ihren feinsten Ausläufern als hygienische
Forderungen für das Individuum erweisen. Sie gehören völlig zur
Individual-Hygiene. Die Urformen der christ- lichen Gesellschaft, der
moderne christliche Socialismus, der Staatssocialismus und die
Socialdemokratie, alle tendiren nach der Richtung dieser drei
Elementar-Forderungen, die eben die allgemeinen socialistischen
Forderungen reprä- sentiren. Die Socialdemokratie speciell vertritt den
Standpunkt, dass die Entwicklung der wirthschaftlichen Verhältnisse
ganz nothwendig zu der Abschaffung des Capitalismus und der Überführung
der Productionsmittel in gesellschaftliches Eigenthum führen werde, und
dass ihre Forderungen conform mit der gesetzmässigen Weiterentwickelung
der mensch- lichen Gesellschaft seien. Der Malthusianismus beschränkt
sich auf die Forderung der angepassten Summen und will damit den auf
der bis- herigen Nicht-Anpassung der Summen beruhenden Kampf um’s
Dasein aufheben. Der Socialliberalismus Herztka’s und die Boden-
reformer im Allgemeinen verlangen nur das für Jeden gleiche Recht, den
Grund und Boden zu benutzen. Sie dehnen dagegen ihre Ansprüche nicht
immer aus auf die gleiche Benutzbarkeit der sonstigen
Productionsmittel, ein Punkt, der sie vom reinen Socialismus
unterscheidet. Hertzka allerdings hat das volle Recht auf Arbeit in
sein Programm aufgenommen. Auch die Bodenreformer hoffen, dass die
Durchführung ihres Systems allein zur Herbei- führung materiell
günstiger Verhältnisse für Alle genügen würde, verlangen aber nicht
direct die Aufhebung des wirthschaftlichen Kampfes um’s Dasein, so dass
sie streng principiell genommen nicht alle (z. B. Henry George nicht)
ein nonselectorisches System vertreten. Gegen die nonselectorischen
Systeme des Socialismus und Malthusianismus nun erhebt die
Rassenhygiene ihre Warnungen und weist darauf hin, dass keine
Gesellschaft für eine lange Dauer von Generationen fortbestehen kann,
wo die Erfüllung der drei nonselectorischen Postulate zur allmählichen
Entartung der menschlichen Rasse führen würde. Betrachten wir zunächst
einmal diese Postulate etwas näher in Bezug auf ihre ganz allgemeinen
Zusammenhänge mit Fortpflanzung und Selbsterhaltung der Individuen, um
später die principiellen Beziehungen zum Rassenprocess würdigen zu
können. Die erste Forderung, die der angepassten Summen, welche
verlangt, dass die Zahl der Menschen und die Grösse der zugänglichen
Natur einschliesslich aller Productions- mittel in richtigem
Verhältniss zu einander stehen und stehen bleiben, ist naturgemäss für
die verschiedenen Nationen ver- schieden je nach dem Grade, in dem sie
die Natur auszu- beuten verstehen. Die Forderung ist wohl für alle
civili- sirten Völker erfüllt, bei allen wäre der Antheil an der Erde
und ihren Schätzen genügend unter einer günstigen socialen Ordnung, die
bei der Gütererzeugung die Productionsmittel gleichmässig zugänglich
machte. Unter dieser Bedingung wäre also von Übervölkerung keine Rede.
Das ist der Standpunkt der Mehrzahl der Socialisten, MarxMarx, Karl.
Das Kapital. S. 645 u. f. — Bebel, August. Die Frau. VIII. Aufl. London
1890. S. 198 u. f. an der Spitze. Sie meinen im Grunde, dass die
jetzigen Einwohner z. B. von Deutschland, im Fall Collectiv-Eigenthum
und -Bewirthschaftung aller Productionsmittel plötzlich eingeführt
werden könnten, eine für den Augenblick genügende An- zahl von
Nährstellen finden würden. Die meisten Socialisten kümmern sich
desshalb um die eigentliche Bevölkerungs- frage nur wenig. Anders die
Malthusianer. Sie fassen den Begriff Über- völkerung in Bezug auf die
nur heute vorhandenen Nähr- stellen, und von diesem Standpunkt aus
haben sie Recht, eine Übervölkerung anzunehmen. Die Zahl der jetzt vor-
handenen oder, was das gleiche, der unter Berücksichtigung aller
Factoren heute möglichen Nährstellen ist eben ab- solut nicht
gleichbedeutend mit der Anzahl von Nährstellen, die vorhanden sein
würden, falls gewisse heutige Ein- richtungen und Zustände wie
Eigenthums-Gesetzgebung, Planlosigkeit der Production, mangelhafte
Intelligenz der Massen etc., nicht existirten, sondern sie ist
bedeutend kleiner. Und für sie trifft es zu, dass sie zu klein ist für
die vorhandene Zahl der Bewerber, und dass sie zu lang- sam wächst, um
mit der natürlichen Vermehrungs-Tendenz der Bevölkerung Schritt zu
halten. Also in Bezug auf die Summe der heute vorhandenen Nährstellen
ist Übervöl- kerung wirklich da und ist die Quelle des
wirthschaftlichen Kampfes um’s Dasein und die Bedingung der natürlichen
Zuchtwahl. Die Malthusianer sagen nun, wenn die Nährstellen sich nicht
so rasch vermehren lassen, gut, so lasst uns die natürliche
Vermehrungs-Tendenz der Menschen dadurch einschränken, dass jedes
Ehepaar nur zwei bis drei Kinder zeugt. Sie wollen damit den
wirthschaftlichen Theil des Kampfes um’s Dasein und das aus ihm
folgende Elend möglichst ausrotten, sehen damit auch wohl die sociale
Frage schon gelöst. Doch die Socialisten beharren in ihrer
überwiegenden Mehrheit dabei, dass die Bevölkerungs-Beschränkung die
schlechte Vertheilung der Güter nicht ändern würde, dass dagegen nach
Einführung ihrer eigenen Reformen keine Übervölkerung mehr vorhanden
sein würde, da sich mit einem Schlage die Zahl der Nährstellen
bedeutend erhöhen würde. So recht die Socialisten nun auch darin haben
mögen, dass das malthusianische Princip für sich allein die sociale
Frage nicht lösen kann, weil es eben nur die Forderung der angepassten
Summen einschliesst, so übel begründet ist ihre Zuversicht, dass sie
selbst dieses Princips gänzlich entrathen können. Da die Durchführung
der socialistischen Ideen wohl noch lange auf sich warten lassen würde
und wegen des organisatorischen Wesens derselben naturgemäss nur sehr
allmählich von Statten gehen könnte, so würde auch die Zahl der
Nährstellen nur sehr langsam ansteigen, und desshalb das
elend-mildernde Moment der Bevöl- kerungs-Beschränkung wohl am Platze
sein. Und zwar nicht bloss in der Zeit bis zur Erfüllung der
socialistischen Forderungen, sondern auch gleich weiter, da ja wegen
der Langsamkeit des wirklichen Fortschritts die Bevölkerung immer hätte
nachdrängen können. Denen, die durchaus nicht vom Glauben abzubringen
sind, dass die Nutzbarmachung der Natur der Vermehrungs- Tendenz
gleichen Schritt halten kann, hat man mit Recht die schliessliche
Grenze der constanten jährlichen Sonnen- strahlung und die Beschränkung
des Raums, besonders für Wohnzwecke, vorgehalten. Es liegt nicht in
meiner Ab- sicht, hier näher auf die ganze Controverse einzugehen. Es
soll nur festgestellt werden, dass die Wissenschaftler überwiegend
annehmen, dass die Bevölkerungs-Beschränkung ein unumgänglich
nothwendiges Mittel sein wird, um die Summen der Menschen und der von
ihnen ausnutzbaren Natur zu einander in ein günstiges Verhältniss zu
bringen. Nur einige wenige Socialisten, vor allem F. A. Lange F. A.
Lange. Die Arbeiterfrage. Winterthur 1879. 5. Cap. besonders S. 238.,
Aveling Aveling, E. Darwinism, and small families. London 1882. und
Kautzky Kautzky, Karl. Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt
der Gesellschaft. Wien 1880., welch’ letzterer dadurch in grundlegender
Weise die socialistische Wirthschaftslehre den ersten bedeutenden
Schritt seit Marx weiter geführt hat, haben die Nothwendigkeit der
Bevölkerungs-Beschränkung klar erkannt, die meisten anderen verlassen
sich auf die unendliche Ausnutzbarkeit des Bodens oder auf das Herab-
gehen der physiologischen Fruchtbarkeit durch die er- langte
Behäbigkeit, eine Annahme, die durchaus unsicher ist, und die, wie der
Zoologe Ziegler richtig bemerkt, aus biologischen Gründen für die
nächsten Jahrhunderte nicht gemacht werden dürfte. Die Frage der
künstlichen Beschränkung hat übrigens längst aufgehört, eine rein
theoretische zu sein. Ganze Völker, wie die Franzosen und Yankees
haben, wie wir ja schon wissen, practisch das Zwei-, richtiger das
Dreikinder- System eingeführt, veranlasst einestheils durch die oekono-
mischen Vortheile für die Familie, anderntheils durch die Abneigung der
Frauen gegen die Mühsale wiederholter Geburten. Andere Völker folgen
langsam nach, so dass möglicherweise manche socialistische Gemeinwesen
nicht vor die Frage gestellt würden, wie man die Bevölkerung be-
schränkt, sondern vor die schwierigere Frage, wie man das Abnehmen der
Bevölkerung verhindert. Die Forderung der angepassten Summen kann auf
die Dauer nur durch eine Verringerung des natürlich möglichen
Nachwuchses erfüllt werden, sei es dass diese auf dem demokratischen
Wege des Neo-Malthusianismus, oder irgend einem aristokratischen der
künstlichen Zuchtwahl zu Stande kommt. Wir werden zum Schluss genauer
auf diese Wege zurückkommen. Die zweite Forderung, die des gleichen
Nutzrechtes, ist eine, deren Durchführung auf zwei Weisen möglich
erscheint. Bei beiden jedoch ist das Gemein-Eigenthum der Gesellschaft
an den Productionsmitteln (Grund und Boden, Capital) nöthig, um die
Aufrechterhaltung des gleichen Anrechts Aller auch für den Nachwuchs zu
garantiren. Entweder die Productionsmittel werden, so gut es geht, in
so viele annähernd gleichwerthige Theile getheilt, wie Mit- glieder der
Gesellschaft da sind, also ähnlich wie in Sparta und der alten
deutschen Markgenossenschaft. Oder die ganze Natur wird
gemeinschaftlich bewirthschaftet, wobei Jeder das Recht auf Arbeit
gewährleistet bekommt. Die erste, die Vertheilungs-Art war früher, wo
die Productions- mittel fast aus nichts weiter als aus Grund und Boden
be- standen, am Platze. Heutzutage wäre eine solche Ver- theilung
schwer, und jedenfalls theilweise nur indirect denkbar, da eine grosse
Zahl der Productionsmittel in Fabriken, Minen, Eisenbahnen u. s. w.
besteht. Für unsere moderne Productionsweise in Grossbetrieben scheint
der zweite Modus, die Productionsmittel von Gesell- schaftswegen zu
bewirthschaften und Jedem das gleiche Recht auf Arbeit und ihren Ertrag
zu gewähren, nicht nur einfacher, sondern auch durch die jetzige
Entwickelung anticipirt. Nur diese zweite, höchstens noch gemischte
Arten werden von den modernen Socialisten vertreten. Für unsere
Forderung ist es im Grunde genommen gleich, auf welche Art jeder sein
Recht an dem gleichen Antheil der Benutzbarkeit der Productionsmittel
bekommt. Voraus- sichtlich würden die einzelnen Völker verschiedene
Wege einschlagen je nach dem Verhältniss zwischen ihrem
individualistischen Unabhängigkeitssinn und dem Streben, viele Güter zu
produziren. Allein immer müsste das Gemein- Eigenthum an den
Productionsmitteln wirklich bestehen und diese in irgend einer Art
jedem Einzelnen in annähernd gleicher Weise zugänglich sein, so dass
jeder Arbeitsfähige in den Stand gesetzt würde, sich die Bedingungen
seiner Erhaltung zu schaffen. Die dritte, die Versicherungs-Forderung,
ist nicht minder eine Consequenz des Princips der Gleichberechtigung.
Was nützt es mir, grollt der Kranke, der Krüppel, das alte
alleinstehende Mütterchen, wenn ich zwar gleichen Antheil an dem
Productiv-Eigenthum habe, allein nicht ge- nügend Arbeitskraft, um ihn
auszunutzen. Sollen sie sich des Daseins freuen wie die Anderen und die
gleiche Fähigkeit haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und sich zu
erhalten, so muss die Gesellschaft ihren Kranken und Schwachen,
natürlich auch den Kindern, auf irgend eine Weise, auf welche, ist hier
gleichgültig, ein menschen- würdiges Einkommen garantiren. Diese
Versicherungs- Forderung steht auf dem socialpolitischen Programm aller
Socialisten. Der Conflict zwischen Individual- und Rassenhygiene. Die
drei nonselectorischen Postulate stehen mit ein- ander in innigem
Zusammenhang, sie sind im Grunde nur einzelne Zweige der sich immer
mehr Geltung schaffenden Individual-Hygiene. Neben dem
wirthschaftspolitischen, mittelbaren Schutz der Schwachen strebt unsere
Zeit einen immer ausgedehnteren directen Schutz der rein körperlich und
geistig Schwachen und Kranken an. Hygiene, Medizin und eine Menge von
Wohlthätigkeits-Einrichtungen arbeiten alle im Sinne des humanitären
und ritterlichen Ideals, dem Schwachen nach Kräften zu helfen. Doch
gerathen alle diese nonselectorischen Schutzmaassregeln und alles Ver-
langen, immer neue zu schaffen, offenbar in lebhaftem Widerspruch mit
dem, was wir in den vorigen Capiteln als die reinen Forderungen der
Rassenhygiene kennen gelernt haben. Die nonselectorischen Forderungen
werden von den Menschen vertreten werden, so lange sie vom Hunger nach
Gütern und nach Gerechtigkeit getrieben werden, aber auch ohne
Erfüllung kann die Menschheit bestehen und hat ungezählte Jahrtausende
bestanden. Wenn dagegen in einem Volk die Grundbedingungen seiner
Erhaltung und seines Fortschritts dauernd geschädigt werden, verfällt
es dem Niedergang und der Vernichtung, womit auch der Er- füllung der
humanen Ideale die Grundlage entzogen wird. Die Forderung des
Rassenwohls bleibt also die Grund- bedingung und der Prüfstein aller
anderen. Was von ihnen geeignet ist, zu einem Stillstand oder einer
noch so lang- samen Entartung der Rasse beizutragen, muss ein für alle
Mal unterdrückt werden. Und hier nun setzt die Kritik beinahe der
Gesammtheit der darwinistisch gesinnten Natur- wissenschaftler ein, um
gegen Socialismus und Malthusianismus und oft genug auch gegen weitere
Humanitäts-Bestrebungen mehr oder weniger offen zu Felde zu ziehen.
Darwin selbst erklärt, offenbar nicht leichten Herzens, im Schluss
seiner „Abstammung des Menschen“: „Wie jedes andere Thier ist auch der
Mensch ohne Zweifel auf seinen gegenwärtigen hohen Zustand durch einen
Kampf um die Existenz als Folge seiner rapiden Vervielfältigung
gelangt, und wenn er noch höher fortschreiten soll, so muss er einem
heftigen Kampfe ausgesetzt bleiben.“ So der deutsche Übersetzer Carus.
Im Original steht freilich: „it is to be- feared, that he must remain
subject to a severe struggle“.Darwin, The descent of man. II. Edit.
London 1882. S. 618. Weshalb die Darwin doch höchstens ehrenden Worte
„es ist zu fürchten“, die überdies noch die absolute Noth- wendigkeit
offen lassen, nicht übersetzt wurden, ist unerfind- lich. Darwin fährt
fort: „Im anderen Falle würde er in Indolenz versinken, und die höher
begabten Menschen würden im Kampf um das Leben nicht erfolgreicher sein
als die weniger begabten. Es darf daher unser natürliches
Zunahmeverhältniss, obschon es zu vielen und offenbaren Übeln führt,
nicht durch irgend welche Mittel bedeutend verringert werden.“ Im
ersten Satz wird der Socialismus, im zweiten der Malthusianismus
abgewiesen. Haeckel, der erste Bannerträger der Selectionstheorie in
Deutschland, tritt schroff dem Socialismus entgegen, von dem er sich
aller- dings kein zutreffendes Bild macht, denn es ist nicht richtig,
dass der Socialismus für alle Staatsbürger gleiche Güter und gleiche
Genüsse verlangt. HaeckelHaeckel, E. Freie Wissenschaft und freie
Lehre. Stutt- gart 1878. S. 73. hegt folgende Meinung über die
Beziehungen der Selectionstheorie zum Socialismus: „Der Darwinismus ist
alles Andere eher als socialistisch! Will man dieser englischen Theorie
eine bestimmte Tendenz beimessen — was allerdings möglich ist — so kann
diese Tendenz nur eine aristokratische sein, durchaus keine
demokratische, und am wenigsten eine socialistische! Die
Selectionstheorie lehrt, dass im Menschenleben, wie im Thier- und
Pflanzen- leben überall und jederzeit nur eine kleine bevorzugte
Minderzahl existiren und blühen kann; während die über- grosse Mehrzahl
darbt und mehr oder minder frühzeitig elend zu Grunde geht .... Der
grausame und schonungs- lose „Kampf um’s Dasein“, der überall in der
lebendigen Natur wüthet, und naturgemäss wüthen muss, diese unaufhör-
liche und unerbittliche Concurrenz alles Lebendigen, ist eine
unleugbare Thatsache; nur die auserlesene Minderzahl der bevorzugten
Tüchtigen ist im Stande, diese Concurrenz glücklich zu bestehen,
während die grosse Mehrzahl der Concurrenten nothwendig elend verderben
muss! Man kann diese Thatsache tief beklagen, aber man kann sie weder
wegläugnen noch ändern. Alle sind berufen, aber Wenige sind auserwählt!
Die Selection, die Auslese dieser „Aus- erwählten“ ist eben nothwendig
mit dem Verkümmern und Untergang der übrigbleibenden Mehrzahl verknüpft
.... Wenn daher der Darwinismus nach Virchow, consequent durchgeführt,
für den Politiker eine „ungemein bedenkliche Seite“ hat, so kann diese
nur darin gefunden werden, dass sie aristokratischen Bestrebungen
Vorschub leistet. Wie aber der heutige Socialismus an diesen
Bestrebungen Freude haben soll, … das ist mir, offen gestanden, absolut
unbegreiflich!“ Auch der Zoologe Oskar Schmidt erhob sich gegen den
Anspruch der Socialisten, mit der Selectionstheorie im Einklang zu
stehen: „Das Resultat unserer Untersuchung ist, dass die
Socialdemokratie, wo sie sich auf den Darwinismus beruft, ihn nicht
verstanden hat, wenn sie ihn aber ausnahms- 14 weise verstanden hat,
mit ihm nichts anzufangen weiss und sein unveräusserliches Princip, die
Concurrenz, negiren muss“.Schmidt, O. Darwinismus und Socialdemokratie.
Bonn 1878. S. 38. Noch deutlicher liess er sich im „Ausland“ ver-
nehmen: „Wenn die Socialisten klar denken, so müssten sie alles thun,
um die Descedenzlehre zu verheimlichen, denn sie predigt überaus
deutlich, dass die socialistischen Ideen unausführbar sind“. Auch
Heinrich Ernst Ziegler, Zoologe in Freiburg, hat sich zur
Nothwendigkeit des Kampfes um’s Dasein in einer kürzlich erschienenen
SchriftZiegler, H. E. Die Naturwissenschaft und die social-
demokratische Theorie. Stuttgart 1894. bekannt, in der er ausserdem die
Socialdemokratie in effigie Bebels zu wider- legen bemüht ist. Auf S.
152 formulirt er seine Über- zeugung in folgenden Sätzen: „Der Kampf
um’s Dasein kann im Menschengeschlecht nicht aufgehoben werden. Er
zeigt sich in den Kriegen der Völker, in der Concurrenz der
wirthschaftlichen Betriebe und in der Arbeitsconcurrenz der Einzelnen“.
Als Anmerkung fügt er hinzu: „Ich rede hier nur vom Kampf um’s Dasein
auf socialem Gebiet. Man könnte auch von einem Kampf um’s Dasein auf
hygienischem Gebiet sprechen, welcher nur die körper- liche
Widerstandsfähigkeit betrifft, und welcher diejenigen Indivividuen
eliminirt, welche für das betreffende Klima und die betreffenden
Lebensverhältnisse zu schwach sind“. Warum wendet sich übrigens Ziegler
dann nicht auch ebenso stark wie gegen den Socialismus gegen seine
Collegen von der medizinischen Facultät? Das wäre doch von seinem
Standpunkt aus, dass die Auslese überhaupt aufrecht erhalten bleiben
muss, nicht mehr wie billig und nur consequent. Diese feindlichen
Auslassungen von Darwinianern gegen den Socialismus und die humanitären
Bestrebungen könnte ich leicht um viele vermehren, ich könnte
Ammon,Ammon, O. Der Darwinismus gegen die Socialdemokratie. Hamburg
1891. Hellwald, Herbert Spencer, Tille und manchen andern
hervorragenden Darwinianer citiren, jedoch die Aus- sprüche würden alle
ziemlich ähnlich lauten, so dass ich den Leser nicht damit ermüden
will. Unter diesen Gegnern befinden sich die Namen so glänzender Sterne
der Wissenschaft, und so überzeugungs- treuer, aufrichtiger Männer,
dass ihre Aussprüche eine grosse Bedeutung gefunden haben. Andrerseits
haben die ethischen Lehren des Christenthums und die ethischen und
wissenschaftlichen Lehren des Socialismus auch wieder warme und
überzeugte Vertheidiger gefunden und zwar sowohl unter Darwinianern wie
Nicht-Darwinianern. Die Versuche dieser letzteren, den Widerspruch der
nonselectorischen Forderungen mit dem Princip des Kampfes um’s Dasein
einfach dadurch zu läugnen, dass sie die natür- liche Zuchtwahl als
unberechtigte Hypothese zurückweisen, darf uns hier natürlich nicht
weiter aufhalten; diese un- zeitgemässe Arbeit müssen wir den
unzeitgemässen Geistern überlassen, die ja noch zahlreich genug vor-
handen sind. Aber aus dem Lager der Darwinianer selbst haben sich
zahlreiche, z. Th. mächtige Vertheidiger erhoben, die es auf
verschiedenen Gedankenwegen unternommen haben, die Hoffnungen der
Menschheit mit den aus der Selections- theorie fliessenden Grundsätzen
der Rassenhygiene zu ver- einigen. Die ganze daraus hervorgehende
Discussion ist um so wichtiger, als es sich längst nicht mehr nur um
Hoffnungen und Erwartungen handelt, sondern um die An- fänge der
Realisation. Denn wir sind bereits mitten im Fahrwasser nicht nur des
privaten, sondern auch des staat- lichen Schutzes der wirthschaftlich
Schwachen und der 14* Schwachen überhaupt. Kranken-, Unfall- und
Altersver- sicherung, Schutz der Arbeiter gegen übermässige Arbeits-
zeit und gegen mancherlei sonstige Beeinträchtigungen durch die
Arbeitgeber, das sind heutzutage gesicherte Errungen- schaften in
vielen Culturländern. Die Gesetzgebung be- wegt sich ziemlich überall
in der Richtung des weiteren Ausbaues dieser grundlegenden Anfänge, und
das Ver- langen nach dem verfassungsgemäss garantirten Recht auf Arbeit
— und damit auf den Lebensunterhalt und den Schutz vor den
hauptsächlichsten ausmerzenden Factoren — hat sich aus einer
theoretischen zu einer von grossen Par- teien gestützten politischen
Forderung entwickelt. In wei- terem Sinne richtet sich auf den Schutz
der Schwachen die Arbeit aller der tausend privaten Wohlthäter, sowie
ein grosser Theil der ärztlichen Thätigkeit. Die ganze Frage ist also
keine akademische mehr, sie beansprucht das öffentliche Interesse. Es
handelt sich eben um die allerersten Garantien jeder Gesellschaftsform,
um die Erhaltung des gesunden, blühenden Lebens. Die etwa mögliche
Vereinbarung der socialistisch-humanen For- derungen mit denen der
Rassenhygiene wäre demnach von der grundlegendsten Bedeutung für die
fernere Entwickelungs- richtung der menschlichen Gesellschaft. Daher
verdienen die von Darwinianern und darwinistisch gesinnten Socialisten
gemachten Vereinigungsvorschläge die grösste Aufmerk- samkeit.
Vorschläge zur Lösung des Conflicts. Der leichtfertige Rath zu warten,
bis unsere Nachkommen einmal eine Lösung finden, mag ja ganz practisch
sein, gibt uns aber keine Handhabe zur Discussion. Der Hinweis darauf,
dass später der Kampf der Einzelnen unter einander durch den der
Gesammt- Menschheit gegen die Natur ersetzt werden würde, erscheint
jedem Darwinianer sofort als Missverständniss des eigent- lichen
Problems. Als wenn nicht gerade der Kampf um’s Dasein der Einzelnen und
der Völker unter einander der springende Punkt bei der ganzen
Controverse wäre. Auch Männer wie RitchieRitchie, D. Darwinism and
Politics. Humboldt Library No. 125. New-York 1890. und
StiebelingStiebeling, G. Sozialismus und Darwinismus. New- York 1879.
beruhi- gen sich mit dieser Umwandelung des Kampfes. Nach den obigen
Ausführungen ist es nicht nöthig, diesen Punkt näher zu besprechen, der
angebliche Ausweg wird leicht als Missverständniss der eigentlichen
Frage erkannt, um so mehr, als der erwartete Kampf der
Gesammt-Menschheit gegen die Natur durchaus nicht als echter
darwinistischer Extralkampf aufgefasst wird. Andere, wie z. B.
BrocaBroca, Paul. Les sélections. Revue d’Anthropologie. 1. Bd. Paris
1872. S. 707 u. 708. und viele Socialisten, empfehlen eine sorgsame
Erziehung aller Individuen, eine Ausbildung ihrer guten Anlagen durch
Uebung, und hoffen dann, dass nach den Anschauungen von Darwin,
Haeckel, Lamarck, Spencer diese so erworbene stärkere Functions-
fähigkeit der Organe auf die Nachkommen als stärkere An- lage vererbt
und damit eine Vervollkommnung des mensch- lichen Typus hervorgebracht
werde. Dieser Vorschlag steht und fällt mit der Entscheidung der
Vorfrage: Sind im Lauf des Individuallebens erworbene Eigenschaften
ver- erbbar oder nicht? Wie wir bereits im ersten Capitel sahen, ist
der heutige Stand der wissenschaftlichen Forschung für die Beant-
wortung dieser Frage noch nicht reif. Es stehen sich unter den Biologen
zwei Parteien ziem- lich schroff gegenber, so dass ein gänzlich
Unparteiischer auf eine befriedigende Lösung verzichten muss, wenn auch
mit schwerem Herzen. Denn was gäbe es hoffnungsvolleres für die
Entwickelung der Menschheit, als wenn wir durch richtige Uebung der
Hirnfunctionen und Vererbung der Uebungsresultate die Vervollkommnung
unmittelbar beein- flussen und rascher als durch natürliche Zuchtwahl
höheren Stufen entgegen führen könnten? Der Kampf ums Dasein mit all’
seinem Jammer wäre im Princip entbehrlich ge- worden, die Verbesserung
der Devarianten, die Verstär- kung der Regulations-Anlagen der Kinder
würde ja ganz unmittelbar durch Uebung der elterlichen Anlagen zu
Stande kommen. Darwinianer, die eine Vererbbarkeit er- worbener
Eigenschaften annehmen, wie Haeckel und Spencer, können schon aus
diesem Grunde keinen prin- cipiellen Gegensatz zwischen den
nonselectorischen Forde- rungen und den aus der darwinistischen
Entwickelungs- theorie ableitbaren rassenhygienischen Forderungen auf-
stellen. Aber wir wollen uns auch angesichts dieser freudigen Aussicht,
die die Vererbbarkeit von Uebungsresultaten für die Verminderung
menschlichen Elends eröffnen würde, nicht zu kritikloser Anerkennung
eines blossen Glaubens- satzes, und das ist die Vererbung erworbener
Eigenschaften heute noch, hinreissen lassen. Etwa drei Viertel der Bio-
logen soll sich dagegen und nur ein Viertel dafür ausge- sprochen
haben. Daraus folgt ja an und für sich nichts, es wird nur die
herrschende Strömung gekennzeichnet. Aber halten wir das fest: so wenig
wie die Vererbung er- worbener Eigenschaften exact bewiesen ist, so
wenig ist sie exact widerlegt. Die Experimente, die diesen für den
Menschenfreund so wichtigen Punkt klar stellen könnten, sollen erst
noch angestellt werden. (Vgl. S. 24.) Die bisher angestellten
entscheiden principiell nichts. Jeden- falls berechtigt der heutige
Stand dieser Frage uns nicht dazu, die Vereinbarkeit der
nonselectorischen mit den rassen- hygienischen Forderungen darauf zu
basiren. Das ist denn auch von verschiedenen Seiten berück- sichtigt
worden, und hat dazu Veranlassung gegeben, sowohl die künstliche als
die geschlechtliche Zuchtwahl heranzuziehen. Für künstliche Zuchtwahl
hat sich z. B. der berühmte Vererbungsforscher Francis Galton aus-
gesprochen. Er will ein staatliches Censur-System für
Familientauglichkeit, das sich auf Fachurtheile über Ge- sundheit,
Intelligenz und sittliches Verhalten gründen soll. Inhabern guter
Censuren soll durch ausreichende Staats- unterstützung die Gründung
einer Familie ermöglicht werden. Wallace bemerkt sehr richtig zu diesem
Vorschlag, dass er wohl die Tendenz haben würde, die Zahl unserer be-
gabtesten Männer zu vermehren und ihr Niveau zu heben, dass er aber
gleichzeitig die grosse Menge der Bevölkerung gar nicht treffen würde.
Was wir brauchten, sei aber nicht nur ein höheres Niveau der Vollendung
für Wenige, sondern ein höheres Niveau für den Durchschnitt. Ausserdem
ist Galton’s Vorschlag zu sehr auf die Concurrenzwirthschaft berechnet.
Bei den nonselectorischen Wirthschafts-Systemen würden sich Liebende,
wenn sie nur die Aussicht auf hinreichenden Unterhalt ihrer Familie
hätten, schwerlich um staatliche Unterstützung kümmern. Es wird soviel
davon erhofft, dass später die Heirathen öfter aus Liebe als aus allen
möglichen anderen Motiven geschlossen werden, da muss man dann aber
auch mit dem ganzen rücksichtslosen und unbedachten Vorgehen von
Liebesleuten rechnen. Hiram Stanley (in milderer Form auch Broca) denkt
ebenfalls an eine künstliche Zuchtwahl, um der nach seiner Ansicht
jetzt bereits drohenden Entartung der Cultur- menschheit zu begegnen.
Er will das Vorrecht, Kinder zu erzeugen, für eine durch
wissenschaftliche Fachleute aus- gesuchte Minderheit reserviren.
Wirksam wäre das ja zweifellos, allein glaubt dieser Bürger der
grössten demo- kratischen Republik wirklich, dass moderne Menschen, die
sich um ihr Wahlrecht die Köpfe blutig schlagen, je dahin kommen
werden, sich das Recht auf die Familie weg zu decretiren? Auch Hegar,
einer unserer bedeutendsten Gynaeko- logen, erhofft fast Alles von
einer richtig geleiteten künst- lichen Zuchtwahl: „Wenn wir aber weiter
gehen und dahin streben, die nächsten Generationen zu verbessern, eine
kräftige und edle Rasse zu schaffen, so ist eine methodische Zuchtwahl
jedenfalls das beste und sicherste Mittel, mit welchem in
verhältnissmässig kurzer Zeit schon recht viel zu erreichen
wäre“.Hegar, A. Der Geschlechtstrieb. Stuttgart 1894. S. 136.
Speciellere Vorschläge, wie diese künstliche Zuchtwahl geregelt werden
müsste, macht Hegar übrigens nicht. Wir kommen schliesslich zu den
Erwartungen, die auf eine verbesserte, aber frei wirkende
geschlechtliche Zucht- wahl gesetzt worden sind. Grant Allan, ein
bekannter englischer Schriftsteller, schlägt die völlige Abschaffung
der rechtlichen Einschränkungen über die Ehe vor, die nur so lange
dauern soll, wie beide Theile es wünschen. Überdies soll den Mädchen
durch die Erziehung, sowie den Druck der öffentlichen Meinung
beigebracht werden, dass es die Pflicht jedes gesunden und gescheidten
Weibes sei, so viele und so vollkommene Kinder wie nur möglich zu
bekommen. Zu diesem Zwecke sollen sie sich die schönsten, gesundesten
und intelligentesten Männer zu zeit- weiligen Gatten aussuchen. Hierin
steckt ein gutes Stück Utopie. Gut erzogene Mädchen von heutzutage
wissen recht wohl, dass sie als blosse Gebärmaschinen und
Kleinkinder-Wärterinnen nicht zu ihrem vollen Lebensgenuss kommen
würden. Wenn man auch versuchen würde, ihnen solche Gesinnungen
anzuerziehen, so würde doch die schöne Litteratur, die man nicht
censiren oder verbieten kann, und die wohl nie das blosse, fortwährende
Kindergebären und -Aufpäppeln als schönsten Erdengenuss predigen wird,
einen Strich durch die Rechnung machen. Das bewusste Weib lehnt sich
heute schon gegen eine zu starke Inanspruchnahme im Dienste der Gattung
auf. Wo die moderne Frau am höchsten entwickelt ist, wie in Amerika und
England, kommt das Streben nach fester Monogamie und kleiner Familie,
sowie die manchmal sogar zu starke Abneigung gegen das viele
Kindergebären voll zum Ausdruck. Ein, zwei, allerhöchstens drei Kinder,
weiter versteigt sich das Ideal des modernen Weibes nicht. Die
Hoffnung, das bessere, gescheidtere Weib werde freiwillig mehr Kinder
zeugen als die andern, scheint mir auf Sand gebaut. Wallace’s Ansicht
über die Lösung. Bei Weitem die bestgegründeten Ansichten über die
Lösung des Conflicts hat bisher Alfred Russel Wallace, einer der
berühmtesten Naturforscher geäussert, derselbe Mann, der zugleich mit
Darwin und unabhängig von ihm die Selectionstheorie aufstellte, und der
später trotz seines Alters mit mehr Herzensfrische, als sie viele
unserer jungen Gelehrten aufbringen, für seine humanen und
socialistischen Ideale eintrat. Wallace erkannte klar den inneren
Conflict zwischen diesen letzteren und der Selectionstheorie und legte
sich die natürliche Lösung desselben in einer Weise zurecht, die
principiell völlig auf der Grundlage der Selectionstheorie steht. Er
war der erste berechtigte Socialist auf darwinistischem Boden. Darwin
hatte für eine solche Stellungnahme in wirthschaftlicher Beziehung
nicht genügend lebhafte Interessen, war auch im Allgemeinen stets
schüchtern, sobald es sich darum handelte, aus seiner Theorie weit-
gehende Schlussfolgerungen zu ziehen. In Anbetracht der Wichtigkeit des
Gegenstandes will ich Wallace’s Ansicht ausführlich mit seinen eigenen
Worten wiedergeben: „So bleibt uns denn nur noch übrig, uns zu
überlegen, welche Mittel in einer solchen socialistischen Gesellschaft
eine dauernde Hebung der Rasse ermöglichen würden, wenn wir annehmen,
dass die Bildung als directe Kraft für diesen Zweck wirkungslos bleibt,
da ihre Wirkungen nicht erblich sind, und doch eine Auslese in irgend
welcher Form eine absolute Nothwendigkeit ist. Diese Hebung wird meiner
Meinung nach sicherlich erreicht werden durch die Wirksamkeit der
Wahlfreiheit der Frauen hinsichtlich der Ehe. Sehen wir also zu, wie
diese vermuthlich wirken würde. Man wird allgemein zugeben, dass,
obgleich viele Frauen jetzt mehr aus Noth als aus freier Wahl unver-
heirathet bleiben, es immerhin eine beschränkte Anzahl giebt, die keine
starke Neigung zur Ehe fühlen, die einen Mann nur nehmen, um sich den
Unterhalt oder ein eigenes Heim zu sichern …. In einer Gesellschaft, in
der alle Frauen in der Geldfrage unabhängig wären …, würde die Anzahl
derer, die aus eigener Wahl unverheirathet bleiben würden, stark
wachsen …. Andrerseits ist die leidenschaftliche Liebe beim Mann
allgemeiner und ge- wöhnlich stärker. Und da in einer Gesellschaft, wie
sie durch unsere Forderungen gekennzeichnet ist, sich kein anderer Weg
ausser der Ehe bieten würde, ihr zu genügen, so würde fast jedes Weib
Anträge empfangen, und damit würde wiederum eine auslesende Function in
die Hände des weiblichen Geschlechts gelegt werden. Unter dem Druck der
hier vorgeschlagenen Erziehungsweise und der öffentlichen Meinung würde
diese Auslesefunction auch thatsächlich ausgeübt werden. Die
Arbeitsscheuen und die Selbstsüchtigen würden fast allgemein Körbe
erhalten. Die mit einer Krankheit Behafteten oder geistig Schwachen
würden ebenso in der Regel ehelos bleiben …. Diese Art der Hebung der
Rasse durch Ausscheidung der Schlechtesten hat viele Vortheile über die
andere Art, das frühe Heirathen der Besten sicher zu stellen. Erstlich
ist es die directe statt der indirecten Art, denn es ist wichtiger und
wohlthätiger für die Gesellschaft, den Durchschnitt ihrer Mitglieder zu
heben, indem sie die niedrigsten Typen ganz beseitigt, als die höchsten
noch ein wenig höher zu heben. Ausnahmsweis grosse und gute Menschen
werden immer in genügender Zahl producirt und sind auf jeder
Civilisationsstufe immer producirt worden. Von ihnen brauchen wir nicht
so nothwendig mehr, als wir weniger Schwache und Schlechte brauchen.
Dieses Ausjätesystem ist die Art und Weise der natürlichen Auslese
gewesen, durch die das Thier- und Pflanzenreich so gestiegen ist und
sich entwickelt hat. Das Überleben der Tüchtigsten bedeutet in
Wirklichkeit die Vernichtung der Untüchtigen. In der Natur geschieht
diese in ganz ungeheurem Maasse, weil in Folge der rasenden Vermehrung
der meisten Organismen die jährlich vernichteten Untüchtigen einen
grossen Bruchtheil der Geborenen bilden. Unter unserer bisherigen
unvollkommenen Civilisation ist dieser heilsame Process, soweit er die
Menschen betrifft, neutralisirt worden. Aber diese Neutralisirung ist
das Ergebniss der höheren Eigenschaften unserer Natur gewesen. Die
Humanität, dieses wesentlich menschliche Gefühl, hat uns das Leben der
Schwachen und Leidenden, der Krüppel und Unvoll- kommenen an Geist und
Körper retten lassen. Das hat der körperlichen und geistigen
Rassehebung einigermaassen im Wege gestanden; aber es hat uns sittlich
gehoben durch die anhaltende Entwickelung der bezeichnenden und Alles
krönenden Zierde unserer menschlichen Natur als unterschieden von
unserer thierischen. Eine zukünftige Gesellschaft wird diesen Mangel
ab- stellen, nicht durch Verminderung unserer Humanität, sondern
dadurch, dass sie das Entstehen und Wachsen eines noch höheren
menschlichen Kennzuges fördert, die Bewunderung alles dessen, was schön
und freundlich und opferfreudig ist, und die Bekämpfung alles
Selbstsüchtigen, Gemeinen und Grausamen. Wenn wir uns in unserem
Verhalten gegen unsere Mitmenschen durch Vernunft, Gerechtigkeit und
Allgemeinsinn leiten lassen und uns zu dem Entschlusse aufraffen, durch
Anerkennung des gleichen Anrechts aller Bürger unseres gemeinsamen
Landes auf einen gleichen An- theil an dem Reichthum, den das
Zusammenwirken Aller erzeugt, die Armuth abzuschaffen, — wenn wir somit
das geringere Problem der vernunftgemässen socialen Organisation gelöst
haben, die die gleiche Wohlfahrt Aller zu sichern geeignet ist; dann
können wir das weit höhere und tiefere Problem der Hebung der Rasse
getrost dem gebildeten Geist und dem reinen Gefühl der Frauen dieser
herauf- kommenden Zeit überlassen“.Wallace, A. R. Menschliche Auslese.
Zukunft von Harden. No. 93. Berlin, 7. Juli 1894. S. 21 ff. Hieraus
geht hervor, dass Wallace sich nicht nur des Conflicts zwischen den
humanen Idealen, insbesondere dem Socialismus, und den Forderungen der
Rassenhygiene deutlich bewusst ist, sondern auch, dass die Lösung, wie
er sie sich denkt, völlig im Rahmen der modernen Entwicke- lungslehre
liegt. Er glaubt, dass sich eine verbesserte sexuelle Zuchtwahl
schaffen lässt, und dass sie die starke Abschwächung der natürlichen
und besonders der wirth- schaftlichen Zuchtwahl völlig ausgleichen
kann.In ähnlicher Art denkt sich Aveling die Vereinigung des
Malthusianismus mit der Selectionstheorie. Vgl. Darwinism and small
families. London 1882. Das sieht natürlich sehr bestechend aus und ist
zweifel- los von allen bisher gebrachten Lösungsversuchen weitaus der
berechtigste. Die bessere sexuelle Zuchtwahl wird auch sicherlich in
einer verfeinerten Cultur ihre bedeutende Rolle spielen. Allein einige
Zweifel an das Ausreichende dieser Rolle drängen sich doch demjenigen
auf, der die menschliche Natur etwas weniger optimistisch ansieht. So
ist schwer daran zu glauben, dass bei ökonomischer Sicherstellung
beider Geschlechter die Frauen sich noch öfter des Heirathens enthalten
würden als heutzutage. Die Statistik lehrt überall, dass bei Besserung
der wirthschaft- lichen Lage eines Volkes die Zahl der Eheschliessungen
sich rasch hebt. Wenn wir sehr verschieden reiche Völker mit einander
in Bezug auf ihre Eherate vergleichen, so be- merken wir durchaus
keinen vermindernden Einfluss der Wohlhabenheit. Die armen Irländer
verheirathen sich viel weniger häufig als die wohlhabenden Engländer.
Um noch die Eheraten einiger anderer Länder mit heranzuziehen, so
kommen auf 1000 Einwohner in den Jahren 1871 — 80 Eheschliessungen in
Irland 4,7 Griechenland 5,8 Rumänien 6,4 Schweden 6,6 Norwegen 7,2
Belgien 7,3 Italien 7,7 Spanien (1861—70) 7,7 Schweiz 7,7 Dänemark 7,8
Frankreich 8,0 Grossbritannien 8,0 Niederlande 8,1 West-Oesterreich 8,1
Finnland 8,3 Deutsches Reich 8,6 Galizien 9,1 Russland 9,3 Ungarn 10,2
Serbien 11,4 Nordatlantische Staaten der Union 9—11 Arme Länder stehen
am Anfang wie am Schluss der Reihe, die nach der Zunahme der Eheziffer
geordnet ist. Es dürfte somit schwer sein, hieraus irgend einen vermin-
dernden Einfluss der Wohlhabenheit zu folgern. Die Be- fürchtung, dass
die Zahl der Ehen sich unter den ge- sicherten ökonomischen
Verhältnissen des Socialismus ganz bedeutend steigern würde, ist oft
ausgesprochen worden. Eine wirklich bedeutende Abnahme der Neigung zum
Heirathen wäre übrigens auch, wie wir im zweiten Capitel sahen, in
Anbetracht der wachsenden Tendenz zum Zwei- kindersystem eine Gefahr
für den Bestand der Bevölkerung. Aber setzen wir einmal den Fall, die
Zahl der Frauen, die höhere Ansprüche an den Mann stellen, den sie hei-
rathen wollen, nähme ziemlich zu, so wäre doch immer bei durch die
Erziehung zu hoch geschraubten Ansprüchen die contraselectorische
Gefahr vorhanden, dass die gröber organisirten, die leichtsinnigeren,
die sinnlicheren Frauen früher und öfter zur Ehe schreiten würden, als
die feineren Frauen mit ausgebildetem Geschmack. Es ist auch nicht zu
leugnen, dass viele Männer edlere Frauentypen zwar bewundern, aber
niedrigere, coquettere, sinnlichere bei der Gattenwahl vorziehen. Dazu
kommt, dass es, wenn auch nicht so viel wie heute, doch genug
minderwerthige Individuen beiderlei Geschlechts geben wird, die ganz
gut wissen, dass sie nicht so be- gehrenswerth sind und ihre Ansprüche
dementsprechend herabschrauben, und die nun, da keine ökonomischen
Schwierigkeiten da sind, ruhig zur Ehe mit Individuen des anderen
Geschlechts schreiten, die gleich minderwerthig sind. Man sieht doch
auch heute die merkwürdigsten, ja geradezu widerwärtige Personen eine
Ehe eingehen. Das geht soweit, dass bei grossem Abstande in der rein
mensch- lichen Rangordnung der körperlichen und geistigen Tüchtig- keit
oft eine instinctive Abneigung gegen dauerndes Zu- sammenleben
vorhanden ist, weil auch der niedere Theil deutlich fühlt, dass er da
nicht hingehört und dass er sich nur ungemüthlich und zurückgesetzt
fühlen würde. Dieser Factor des Heirathens von minderwerthigen Personen
unter einander, die doch auch ihre Ansprüche an Familienglück
realisiren wollen, würde von um so grösserer Bedeutung werden, als dem
Manne die Ent- schädigung für die Ehelosigkeit durch die Prostitution,
wie sie ihm heute geboten wird, nicht mehr, oder nur noch in geringem
Maasse möglich sein wird. Er wird viel häufiger als heute in die Lage
kommen, entweder auf jeden ge- schlechtlichen Verkehr verzichten, oder
eine Frau heirathen zu müssen, die zwar nicht zu den besten und
schönsten gehört, die aber doch ein Weib ist, das ihn lieben kann.
Grade der Mann wird in seinen zwanziger Jahren alles mögliche
aufbieten, zum Liebesgenuss zu gelangen. Das ist ein ziemlich allgemein
anerkannter anthropologischer Unterschied vom Weibe. Diese Einwürfe,
die ich der Ansicht Wallace’s mache, sollen nun nicht für die
socialistische Gesellschaft eine grosse Tendenz nach Verbesserung der
sexuellen Zuchtwahl ableugnen. Solche Tendenz wird sich sicher
einstellen und wird durch die Fernhaltung der schlechtesten Individuen
von der Ehe eine ausjätende Function ausüben. Was ich durch meine
Einwürfe betonen will, ist nur, dass ich den Grad oder das Maass der
Ausjätung durch solche bessere sexuelle Zuchtwahl nicht für ausreichend
halte, um den mächtigen Verlust an natürlicher Ausjätung, den die
menschliche Rasse bei der völligen Durchführung der nonselectorischen
Systeme erleiden würde, zu ersetzen, oder um ein sogar noch wirksameres
Moment für die Hebung der Rasse zu bilden. Ich zweifle, ob diese ver-
besserte sexuelle Zuchtwahl quantitativ so stark arbeiten wird, dass
alle schlechteren Devarianten wirklich ausge- jätet werden. Ich glaube,
es ist im Interesse der nonselectorischen Forderungen nöthig, sich noch
nach weiteren Garantien umzusehen. Dies wird um so nothwendiger sein,
als — und das ist mein letztes Bedenken gegen Wallace’s An- sicht —
eine schärfere sexuelle Zuchtwahl, wie sie durch eine
zweckentsprechende Erziehung der jungen Leute zu höheren Ansprüchen
herbeigeführt werden könnte, doch auch immer Hand in Hand geht mit
einer schärferen Aus- jäte. Nun ist hier ja zweifelsohne diese Form der
Aus- merzung nicht mit dem Elend verbunden, wie so oft die
wirthschaftliche und andere Formen. Allein ein gewisses Quantum Elend
und Schmerzen ist auch mit der sexuellen Ausjätung verbunden. Es ist
nicht nur die gesellschaftliche Stellung der alten Jungfer, die viele
ältere Mädchen quält, es sind nicht nur ihre all- mählich eintretenden
psychischen Verschiedenheiten von den verheiratheten Frauen, sondern
vor allem das bei liebe- bedürftigen Naturen stark ausgeprägte
Verlangen nach einer innigen Lebensgemeinschaft, wie sie eben nur mit
einem Manne, selten mit Frauen, möglich ist, und wohl am meisten die
Sehnsucht nach einem Kinde, das mit Mutterlust gehegt und gepflegt, und
das auch dem einsamsten Weibe Zweck und Inhalt seines Lebens werden
kann. Der Mann dürfte ebenfalls bei seinem lebhaften Liebesverlangen
die stärkere sexuelle Ausjätung durchaus nicht als gleichgültig
empfinden. Es wäre überdies zu fürchten, dass seine aggressive Natur
sich doch in irgend einer Art Luft machen würde, und dass
möglicherweise dadurch die Neigung zu lockeren Geschlechts-
verhältnissen bei Frauen mit niedrigen Anlagen angefacht und benutzt
werden könnte, wodurch der Syphilis und anderen Geschlechtskrankheiten
immer noch ihr günstiger Boden erhalten bliebe. Das humane Ideal möchte
eben alle und jede schmerz- hafte Ausjäte schmerzempfindender Menschen
möglichst verhindern und andere Entwickelungs-Factoren an ihre Stelle
setzen. Aber ist das überhaupt möglich? Giebt es irgend einen Ausweg,
der mit den als wahr erkannten darwinistischen Principien vereinbar
ist? Lösung durch Beherrschung der Variabilität. Solch ein Ausweg
scheint sich in der That zu eröffnen durch das Bestreben, die Gesetze
der Variation genauer zu erforschen und sie bewusst auf die
Verbesserung der De- varianten, d. h. des Nachwuchses, anzuwenden. Je
mehr wir im Stande sind, die Erzeugung schlechterer Kampf um’s Dasein,
um sie wieder auszujäten. Wir würden ihn gar nicht mehr brauchen, wenn
wir es in unsere Macht bekämen, in jeder Generation der Gesammtheit der
ge- borenen Devarianten einen etwas höheren Durchschnitt zu geben, als
die Gesammtheit der Eltern ihn hatte. Ich habe diesen Gedanken schon
vor einigen Jahren in folgender Form ausgesprochenTrostworte an einen
naturwissenschaftlichen Hamlet. New- Yorker Volkszeitung v. 6. Nov.
1892.: „Sollte es nicht noch einen Ausweg geben? Der Menschengeist
bezwingt so viel. Wenn er erforschte, welche Bedingungen es sind, unter
denen die Eltern Kinder zeugen, welche bessere Anlagen haben als sie
selbst, wenn er die Gesetze der Variabilität erforschte und ihre
Erscheinungen unter seine Macht beugte! Einen kleinen Theil kennt er ja
schon, bei den Thieren sogar einen ziemlich grossen. Dann wäre der
Fortschritt gewähr- leistet, der Kampf um’s Dasein, der bewusste und
unbe- wusste Wettbewerb der Einzelnen um Nahrung und Kinder, wäre
überflüssig zur Erhaltung und Vervollkommnung der Kraft und Schönheit
unserer Art.“ In ganz allgemeiner Weise, die allerdings hauptsächlich
das Princip der künstlichen Zuchtwahl und die Vererbung von
Erziehungs-Resultaten, also erworbener Eigenschaften, heranzieht,
erwartet auch Bebel eine ähnliche Lösung des Conflicts von der
steigenden Einsicht der Naturwissenschaft: „Vermag man mit
zweckbewusster Anwendung der Natur- gesetze die Züchtung ganz
veränderter Gestalten und selbst Arten in der Thier- und Pflanzenwelt
hervorzubringen, mit fast unglaublich erscheinenden Veränderungen, so
werden diese — die Entwickelungsgesetze auf die Menschen- erziehungDas
Wort „Erziehung“ ist im Original nicht durch gesperrten Druck
hervorgehoben. angewandt — schliesslich auch dahin führen, bestimmte
körperliche und geistige Eigenschaften hervor- 15 rufen zu können,
welche ihm die harmonische Entwickelung ermöglichen“. Bebel, A. Die
Frau und der Socialismus. XII. Aufl. Stutt- gart 1892. S. 199. Auch
Hegar Der Geschlechtstrieb. Stuttgart 1894. S. 136. hat eine kurze
Bemerkung über die Variations-Beherrschung gemacht: „Der andere Weg
(eine kräftige Rasse zu schaffen), durch Lebensweise, Umgebung,
Erziehung, kurz durch die Umgestaltung der Aussenwelt auf den
Organismus der vorhandenen Generation, dann durch dessen Veränderung
auf die Keime und durch deren Variationen auf die Eigenschaften der
folgenden Generation einwirken zu wollen, ist umständlich, langwierig
und unsicher, zumal unsere Kenntnisse uns nicht erlauben, feste Normen
über die zweckmässige Art dieser Beeinflussung aufstellen zu können“.
Doch die vermeintliche Schwierigkeit des Weges, die Hegar sich durch
Trennung des in Wirk- lichkeit einheitlichen Vorgangs in drei nur
begrifflich ge- schaffene Abschnitte unnöthig vergrössert, schreckt ihn
um so leichter ab, als ihn nicht der Conflict der nonselectori- schen
Systeme mit der Selectionstheorie zur Erwägung des Problems veranlasst;
wenigstens erwähnt er nichts davon. Die Lösung des Conflictes durch die
Beherrschung des Variirens und ihr sonstiger directer Vortheil für die
Rasse ist mir seitdem immer mehr einer eingehenden Be- trachtung werth
erschienen. In einem Aufsatz Neue deutsche Rundschau. S. Fischer.
Berlin. V. Jahrg. 1894. S. 989. (Octoberheft.) über „Rassentüchtigkeit
und Socialismus“ versuchte ich eine kurze principielle Begründung, um
sie schliesslich durch diese Arbeit in den Rahmen zu setzen, in welchen
sie hinein- gehört, nämlich in den einer Rassenhygiene. Ehe wir den Weg
der Variations-Beherrschung darauf- hin prüfen, ob er gangbar ist, und
ob wirklich Aussicht vorhanden ist, dass er uns zu dem ersehnten Ziel
der Vereinbarkeit der humanen und rassenhygienischen Forde- rungen
leiten wird, wollen wir noch einige Worte zu seiner rein theoretischen
Begründung sagen. Wenn der aufmerksame Leser sich erinnert, was wir am
Schluss des ersten Capitels über das gegenseitige Ver- hältniss und die
Bedeutung der drei Entwicklungsfactoren Variation, Auslese nnd
Vererbung, sowie im dritten Capitel über die Wirkung der Panmixie und
die rassenhygienischen Forderungen ausgeführt haben, werden ihm die
folgenden Sätze beinahe selbstverständlich erscheinen. Eine erzeugte
Generation umfasst vielerlei Convarianten, starke und schwache,
vollkommene und weniger voll- kommene, oder kurz gute und schlechte.
Diese Ver- schiedenheit führt in der Concurrenz, die durch das Miss-
verhältniss zwischen Vermehrung der Menschen und An- wachsen der
Nährstellen bewirkt wird, zu einer Auslese der besseren und einer
Ausjäte der schlechteren Con- varianten. Hierdurch wird die Gesammtheit
der sich fort- pflanzenden Individuen gegenüber der der überhaupt Ge-
borenen bedeutend verbessert, so dass nun durch die Vererbungstendenzen
die alte Höhe des Typus der Rasse bewahrt oder sogar noch weiter
getrieben wird. Vorbedingung zu diesem Überleben der Tüchtigsten, zu
ihrer Auslese im Kampf um’s Dasein, war natürlich, dass sie überhaupt
erst einmal erzeugt wurden. Vor- bedingung auch zu jeder
Vervollkommnung der Rasse war, dass sie in vermehrtem Maasse und in
steigend besserer Qualität überhaupt erst erzeugt wurden. Wir erkannten
die aufsteigende Variation als das eigentlich fortschrittliche Element,
den Kampf um’s Dasein nur als das regulirende. Daraus erhellt ganz
unmittelbar, dass, gleiches Tempo der Vervollkommnung vorausgesetzt,
die Ausjäte um so weniger einzutreten braucht, einen je grösseren
Antheil von der Summe der erzeugten Individuen überhaupt die guten
Convarianten ausmachen. 15* Das Verhältniss wird noch deutlicher, wenn
wir anstatt mit Convarianten mit Devarianten rechnen, also zwei auf-
einander folgende Generationen mit einander vergleichen. Wie wir auf S.
114 bemerkten, ist der Typus einer Generation dann fortgeschrittener
als der der vorhergehenden, wenn die Summe der reifen Individuen der
zweiten Generation durchschnittlich Wenn ich hier und an andern Stellen
einfach durchschnittlich sage, bin ich mir wohl bewusst, dass ein
Vergleich der Durchschnitte von Gesammtsummen durchaus kein
zutreffender ist. Einige sehr tief oder sehr hoch stehende Glieder
können den Durchschnitt stark beeinflussen. In der Statistik und
Anthropologie theilt man des- halb auch häufig die Gesammtsumme in
Abtheilungen und vergleicht deren Durchschnitte. Der Leser möge also
beim Worte Durchschnitt stets an solche abtheilungsweise verglichene
Durchschnitte denken. einen höhern Grad der Vollkommenheit
repräsentirt, als die Summe der reifen Individuen in der ersten
Generation. Dies konnte bei sonst gleichen Be- dingungen nur dadurch
erreicht werden, dass die Summe der erzeugten Devarianten der neuen
Generation, verglichen mit der der alten Generation, einen höheren
Durchschnittswerth darstellt. Die Eltern mussten bessere Devarianten
zeugen, das war der Inbegriff alles Fortschrittes in der Entwickelung
und wird es auch bleiben. Je mehr bessere Devarianten erzeugt wurden,
desto geringer brauchte für dasselbe Tempo der Vervollkommnung der
Kampf um’s Dasein einzugreifen. Wenn nun in unserem Falle als Ideal
verlangt wird, dass gar kein Kampf um’s Dasein, gar keine Ausjätung
eintritt, so liegt auf der Hand, dass die Gesammtheit der erzeugten
Devarianten nicht nur einen höheren Durch- schnittswerth haben muss,
als die Gesammtheit der er- zeugten Devarianten der alten Generation,
sondern sie muss sogar einen höheren Durchschnittswerth haben als die
Gesammtheit ihrer Eltern, d. h. als der bereits ausgelesene Theil der
erzeugten Devarianten der alten Generation. Wenn der Durchschnitt der
gesammten Devarianten auch nur um ein Minimum unter dem der Gesammtheit
ihrer Eltern steht, so muss zur Erhaltung der Höhe der Rasse der Kampf
um’s Dasein für die Paralysirung dieses Minimums genügend gross sein,
wenn aber Hebung der Rasse ge- fordert ist, noch mehr wie die
Beseitigung dieses Minimums leisten und in dem Maasse der
Forderungshöhe stärker sein. Denn sonst würden durch die
geschlechtliche Mischung zwischen den besseren Individuen und denen,
welche die geringere Höhe des Durchschnitts bedingen — gleiche
Vererbungstendenzen vorausgesetzt — die Devarianten der nächsten
Generation unzweifelhaft in ihrem Werthe herab- gedrückt werden. Somit
wird die von uns früher aufgestellte rassen- hygienische Forderung der
Verbesserung der erzeugten neuen Devarianten gegenüber den erzeugten
der alten Generation dann, wenn wir die Ausjäte aufheben wollen dahin
verschärft werden müssen, dass die erzeugten neuen Devarianten in ihrer
Gesammtheit höhere Werthe repräsen- tiren müssen, als die Eltern sie
hatten, die ihnen das Leben gaben. Für jedes Stück des ausjätenden
Kampfes um’s Da- sein, das wir durch Hygiene, durch Therapeutik, durch
socialen und wirthschaftlichen Schutz der Schwachen, durch
socialistische Reformen im Allgemeinen beiseite schaffen, müssen wir
nothgedrungen ein Äquivalent bieten in Form von entsprechender
Verbesserung der Devarianten, sonst ist eine Entartung sicher. Das
glänzende Ideal der Durch- führung aller Forderungen der Humanität und
Gerechtig- keit dagegen ist mit naturgesetzlicher Nothwendigkeit ge-
knüpft an das volle Äquivalent, dass die Gesammtheit aller Devarianten
einen vollkommeneren Durchschnittstyp dar- stellt als die Gesammtheit
der Eltern. Mit anderen Worten, die höchsten Hoffnungen des
Menschengeschlechts können nur Gestalt gewinnen und in kraftvollem
Leben fortdauern, wenn wir zu ihrem Schutz gegen rauhe Naturmächte die
jetzigen dürftigen und lückenhaften Schutzmauern der Hygiene der
Fortpflanzung allmählich zu einem soliden, wohnlichen Gebäude ausbauen.
Im zweiten Bande dieser Arbeit wollen wir sehen, welche Bausteine uns
die moderne Wissenschaft dazu liefern kann, auch selbst einige
hinzufügen und uns überzeugen, dass schon viel Material daliegt und nur
durch seine Zer- streuung in so geringem Maasse Beachtung gefunden hat,
dass die landläufige Meinung der Unwahrscheinlichkeit, die Variabilität
zu beeinflussen, sich halten konnte. Hegar’s citirtes Buch ist,
trotzdem er, wie wir sahen, selbst diese Meinung ausspricht, ein
verdienstvoller Versuch, in dieser Hinsicht Licht zu verbreiten. Hier
wollen wir noch einige Einwände berühren, die leicht erhoben werden
könnten. Das Princip der Auslese ist ein so tiefes, seine Be- deutung
in der Lebewelt eine so allgemeine, dass Darwin und Wallace, sowie
viele ihrer Nachfolger, es stets als unmöglich empfunden haben, je
davon abstrahiren zu können. Auch ich stehe völlig auf diesem Boden.
Dass ich mit der Denkbarkeit der Aufhebung des Kampfes um’s Dasein
unter den Menschen rechne, scheint auf den ersten Blick ein Verlassen
dieses Bodens zu sein. Allein, wenn man näher zusieht, wird das
allgemeine Princip der Auslese nicht verlassen, sondern die Auslese aus
dem Kampf der Zellenstaaten in den Kampf der die Staaten
zusammensetzenden nächst nied- rigen Organisationen, nämlich der
einzelnen Zellen gelegt. Die Menschen sind Zellenstaaten. Die
Keimstoffe, aus denen sie entstehen, sind in lebenden Einzelzellen
verkör- pert, in der Ei- und der Samenzelle. Eine Fortpflanzungs-
hygiene, die z. B. zu junge und zu alte, temporär kränk- liche oder
alkoholisirte Personen von der Zeugung abhält, bestimmte Zwischenräume
zwischen die Geburten legt, für zweckentsprechende Ernährung der Eltern
sorgt u. s. w., besteht darin, von den gesammten produzirten
Geschlechts- zellen nur einzelne wenige, deren Tüchtigkeit wir
irgendwie erschlossen oder bewirkt haben, zur Begattung auszuwählen und
andere durch einfache Abscheidung zu Grunde gehen zu lassen. Die
Fortpflanzungshygiene ist die Lehre von der Beeinflussung der Variation
der Keimzellen und ihrer künstlichen Auslese, und unsere Lösung des
Conflicts der nonselectorischen mit den rassenhygienischen Forderungen
ist — was den Factor der Selection anlangt — nichts weiter, als ein
Verschieben der Auslese und Ausjäte von den Menschen auf die Zellen,
aus denen sie hervorgehen, also eine künstliche Auslese der Keimzellen.
Der Boden des Selectionsprincips ist damit nicht ver- lassen. Der ganze
Artprocess kann ohnedies vollkommen an den Keimzellen durchgeführt
werden. Die Keimdrüsen der erhaltenen reifen Individuen einer Art
produziren eine Menge von Keimzellen, die alle etwas von einander
unterschieden sind — Variation. Von diesen Keimzellen werden, abge-
sehen von der nonselectorischen Vernichtung, überwiegend die meisten
vor, noch andere nach ihrer Vereinigung mit einander zu Individuen
durch selectorische Schädlichkeiten ausgejätet — Auslese. Der
übrigbleibende, ausgelesene Rest hat die Tendenz, seine guten
Qualitäten auf die von ihm durch ausgewachsene Individuen hindurch
wieder neu erzeugten Keimzellen zu übertragen — Vererbung. Unser ganzes
Ein- greifen in diesen Process besteht in nichts weiter, als die
Ausjäte der Keimzellen vor ihrer Vereinigung mit einander zu verstärken
auf Kosten der Ausjäte der Keimzellen nach ihrer Vereinigung mit
einander und ihrem weiteren Aus- wachsen zu Individuen. Dass sogar in
der Natur die Ausbildung von be- stimmten Eigenschaften oder Graden von
Eigenschaften manchmal ohne jeden Kampf um’s Dasein unter den Indi-
viduen erfolgt ist, giebt kein geringerer wie Darwin be- reitwillig zu:
„Es lässt sich auch kaum daran zweifeln, dass die Neigung in einer und
derselben Art zu variiren, häufig so stark gewesen ist, dass alle
Individuen derselben Spe- cies ohne Hülfe irgend einer Form von
Zuchtwahl ähnlich modifizirt worden sind.“ Entstehung der Arten.
Deutsch von Carus. S. 113 u. 114. Ferner schreibt er in einem Briefe an
Moritz Wagner: „Nach meinem eigenen Urtheil liegt der grösste Irrthum,
den ich beging, darin, dass ich nicht genügendes Gewicht der
unmittelbaren Wirkung der Umgebungen (Nahrung, Klima etc.), unabhängig
von natür- licher Auswahl, beilegte.Citirt in Ratzel, Fr.
Anthropo-Geographie. Stuttgart 1882. S. 79. Man könnte auf den ersten
Blick noch zweifeln, ob eine nicht nur erhaltende, sondern wirklich
fortschreitende Variabilität dabei bewahrt bleiben würde. Allein
erstens muss man sich in Erinnerung rufen, dass ja auch alle bis-
herige Vervollkommnung durch Variiren über den Status der Eltern hinaus
entstanden sein muss, dass also in der Natur stets unter den
Devarianten eine Anzahl progressiver vorhanden sind, und zweitens
möchte ich hier an einige Worte von Wallace und Darwin erinnern, die
sich treffend über den Punkt ausgesprochen haben. Wallace meint:
„Ausnahmsweis gute und grosse Menschen werden immer in genügender Zahl
produzirt und sind auf jeder Civilisa- tionsstufe immer produzirt
worden“ Menschliche Auslese. Zukunft von Harden. Berlin 1894. No. 93.
S. 23. und an einer andern Stelle: „Wenn diese Hebung des Durchschnitts
zu Stande gekommen ist, dann muss das Ergebniss auch eine ent-
sprechende Hebung des Hochfluthstriches der Menschheit sein .... Denn
jene günstigen Keimcombinationen, die nach der Theorie, die wir
erörtern, die grossen Männer unserer Tage in’s Dasein gerufen haben,
werden ein viel höheres Material haben, mit dem sie arbeiten können,
und wir können deshalb erwarten, dass die ausgezeichnetsten Dichter und
Philosophen der Zukunft einen Homer und Shakespeare, Newton, Goethe und
Humboldt entschieden überragen werden.“ Menschheitsfortschritt. Zukunft
von Harden. Berlin 1894. No. 96. S. 158. Darwin äussert eine ähnliche
Meinung: „Was die körperliche Structur betrifft, so ist es die Auswahl
der unbedeutend besser begabten und die Beseitigung der ebenso
unbedeutend weniger gut begabten Individuen und nicht die Erhaltung
scharf markirter und seltener Anoma- lien, welche zur Verbesserung
einer Species führt. Das- selbe wird auch für die intellectuellen
Fähigkeiten der Fall sein .... Hat sich in irgend einer Nation die Höhe
des Intellects und die Zahl intelligenter Leute vermehrt, so können wir
nach dem Gesetze der Abweichung vom Mittel, wie Galton gezeigt hat,
erwarten, dass Wunder des Genies etwas häufiger als früher erscheinen
werden. Abstammung des Menschen. Deutsch von Carus. I. Theil S. 178.
Ein erheblicherer Einwand gegen die Lösung durch
Variations-Beherrschung könnte darin erblickt werden, dass wir beim
Fortfall der natürlichen Auslese den Maasstab für die Vervollkommnung
verlieren. Nach unseren Be- trachtungen im dritten Capitel war das
Kriterium der grösseren Vollkommenheit die bessere Befähigung im
extralen wie socialen Kampf um’s Dasein, die höhere Regulations- kraft
gegen die Einflüsse der Umgebung. Wir sahen, dass nicht nur die
körperliche Constitutionskraft im gewöhnlichen Sinne, sondern auch
Schönheit und sociale Tugenden für ihren Besitzer oder den Verband, zu
dem er gehörte, wie Familie, Volk u. s. w., eine Waffe im Kampf um’s
Dasein bedeuteten. Das Maass für diese Elemente der Vollkommenheit
wurde durch den Grad ihres Nutzens im Kampf bestimmt. Jetzt geht mit
einmal durch das Aufhören der Concurrenz der bisherige Richter über die
Eigenschaften der Individuen verloren, ist da nicht zu fürchten, dass
wir in unserer Weiterentwickelung jedes natürliche Ziel verlieren
würden? Dem ist zu entgegnen, dass wir einen durch Millionen von
Generationen erworbenen allgemeinen Maassstab für individuelle
Tüchtigkeit sehr oft als Instinct in uns tragen. Dieser Instinkt ist
als richtende Kraft für die sexuelle Zucht- wahl ausgebildet worden,
wie wir auf S. 108 ausführten, ist durch unzählige Generationen immer
wieder vererbt worden, und hat somit nach biologischen Analogien eine
hartnäckige Tendenz, immer wieder angeboren zu werden. Er wird also
noch auf viele Generationen hinaus nicht nur einen ziemlich festen
Maassstab menschlicher Tüchtigkeit und Schönheit abgeben, sondern sogar
viel freier seine Wirksamkeit entfalten können als jetzt, wo allerlei
Contra- selectionen besonders wirthschaftlicher Art ihm entgegen-
wirken. Dazu kommt, dass uns der weitere Ausbau der Physio- logie mehr
und mehr Methoden zur directen Messung und Vergleichung der
Regulationen an die Hand geben wird, wobei wir unseren Instinct
allmählich durch verfeinerte Ein- sicht ergänzen und ersetzen werden.
Der Theil der Vervollkommnung, der sich bezieht auf die Harmonisirung
der äusseren menschlichen Formen mit etwaigen tief im Geschehen der
Natur verankerten all- gemeinen Schönheits-Principien, würde
selbstverständlich keine Verschiebung erfahren, da der Maassstab dafür
uns ja stets gegenwärtig ist. Von einem haltlosen Herumvagiren des
bewussten Vervollkommnungs-Ideals kann also nie die Rede sein. Wo immer
sich übrigens ein Widerspruch des gewünschten Typus mit den
Extralbedingungen der Natur einzustellen drohte, würde eine Ausjätung
sicher erfolgen, so dass das Vervollkommnungsideal sich stets eng an
die Extralbedin- gungen anschmiegen müsste. Als letztes Hinderniss für
die Beherrschung der Variation könnte man die Möglichkeit ansehen, dass
die wirklich errungenen Kenntnisse einer Fortpflanzungs-Hygiene von den
Massen nicht beachtet und nicht durchgeführt würden. Das A und O dieser
Hygiene ist natürlich die Praxis des praeventiven Geschlechtsverkehrs,
die erlaubt, den Zeitpunkt der Zeugung von den oft nun einmal
unüberwindbaren sinnlichen Bedürfnissen des Augenblicks zu trennen und
ihn auf den gewünschten Termin günstiger Bedingungen zu ver- legen.
Diese Praxis ist bereits heute so vorgeschritten, dass bei ärztlichem
Rathschlage wohl nur sehr beschränkte Personen nicht in Stand gesetzt
werden könnten, sie aus- zuüben. Den Praeventivverkehr als unmoralisch
zu ver- werfen, wie es noch manchmal geschieht, dürfte nur einer
unheilvollen Contraselection Thür und Thor öffnen. Es handelt sich
einfach um die Wahl zwischen diesem grösseren Uebel und dem kleineren
des Praeventivverkehrs. Oder noch richtiger, es handelt sich darum, ob
wir die unleug- bar zunehmende Praeventivpraxis für unsere
rassenhygieni- schen Zwecke ausbeuten wollen oder nicht. Alle unsere
Bedenken, auch liebgewordene aesthetische, werden dem mächtigen Drange
der Zeit weichen müssen. Dass mit solchen Hülfsmitteln die Bevölkerung
auch wirklich in erheblichem Masse von zeugungshygienischen Kenntnissen
Gebrauch macht, kann wohl dadurch bewirkt werden, dass bei der
Erziehung das grösste Gewicht auf die Freude an Tüchtigkeit und
Schönheit der Individuen und der Rasse gelegt, und dass den Massen
aufklärende Litteratur in der liberalsten Weise zugänglich gemacht
wird. Als unterstützender Factor würde noch hinzu kommen, dass Eltern,
die grosse Sorgfalt bei der Erzeugung und Heranziehung ihrer Nachkommen
aufwendeten, dadurch im Kampf um den Nachwuchs ganz erheblich besser
fahren und so ihre Rasseninstincte eher vererben würden als die
Gleichgültigen. Unsere im dritten Capitel formulirten rassenhygieni-
schen Forderungen würden demnach durch ihre Anpassung an die
nonselectorischen Systeme folgendes Ansehen ge- winnen: 1. Die
Gesammtheit der erzeugten Nachkommen muss durchschnittlich einen
höheren — und zwar möglichst viel höheren — Grad der Vollkommenheit
repräsentiren als die Gesammtheit ihrer Eltern. Hierzu ist insbesondere
die Auf- hebung aller solchen nonselectorischen Schädlichkeiten nöthig,
die auch die Keimzellen verschlechtern. 2. Keine Contraselection ausser
Krankenpflege. 3. Die Zahl der erzeugten Nachkommen darf nicht unter
die Zahl der erreichbaren auskömmlichen Nährstellen sinken. Dies hat
nur Bedeutung für eine einzelne Rasse oder ein Volk, das im
Societätenkampfe steht, nicht für die gesammte Menschheit. Vorstehende
Forderungen werde ich für später einfach die modifizirten
Rassenforderungen nennen. Die- selben werden im zweiten Band näher
betrachtet werden. Die Variations-Beherrschung wäre als Garantie in
ihrem vollen Umfange nur dann nothwendig, wenn alle nonselec- torischen
Forderungen, medizinische und wirthschaftliche, verwirklicht' würden.
Von beiden Arten sind nun bis heute schon eine ziemliche Reihe
thatsächlich erfüllt worden; private und öffentliche Hygiene, Kranken-
und Armenpflege, Arbeiterschutzgebung etc., kurz eine ganze Menge von
Maassregeln zum Schutz von allerlei Schwachen sind in fortwährender
Zunahme begriffen, so dass die Verbreitung zeugungshygienischer
Einsichten in grösserem Umfange schon jetzt dringend nothwendig ist.
Für die nächste Zukunft ist speciell auf wirthschaft- lichem Gebiet ein
entschiedenes Weitergehen auf dem Wege der Socialreform nach
socialistischen Zielen hin zu erwarten. Für unsere Frage hier ist es
von secundärem Interesse, ob dies in mehr staatssocialistischer,
christlich-socialer oder social- demokratischer Weise erfolgt. Dazu
kommt eine wachsende Tendenz zum Zweikindersystem, so dass es
zweckmässig erscheint, die schon im Anfang des Capitels aufgestellten
malthuso-socialistischen Elementar-Forderungen für sich allein, ohne
Rücksicht auf medicinisch-hygienische Bestre- bungen, auf ihre
rassenhygienischen Folgen zu prüfen. Die Socialisten und Malthusianer
wollen nicht allen Kampf um’s Dasein aufheben, sondern vorerst nur den
ökonomischen, also einen Theil des Socialkampfes. Der Extralkampf,
durch den Anpassung an Klima und über- haupt ein gut Theil roher
Constitutionskraft bedingt sind, bleibt ziemlich unberührt. Nach dem
Princip der Panmixie würden nun die wirthschaftlichen Eigenschaften des
Menchen von ihrer Höhe herabgehen. Dies würde sich aber nur dann in
grösserem Umfange einstellen, wenn keine anderen Arten der Auslese
bestehen blieben, in denen eben- falls wirthschaftliche oder ihnen
ähnliche Eigenschaften in demselben Maasse gezüchtet würden. Solche
anderen Arten von Auslese giebt es aber, wenn sie auch nicht mit
derselben Kraft wirken. Die im ökonomischen Kampf zum Sieg verhelfenden
Eigenschaften sind hauptsächlich Intelligenz und Vorbedacht, Fleiss und
Arbeitskraft, Energie, Gesundheit und ein ge- wisses Verhältniss
zwischen Altruismus und Egoismus. Ich glaube, Niemand wird leugnen,
dass abgesehen vom Egoismus, den ja nicht bloss die Socialisten lieber
kleiner wie grösser haben möchten, diese Tugenden auch in anderen Arten
von Auslese wie grade der wirthschaftlichen eine grosse Rolle spielen.
Bei der sogar in wohlhabenden Kreisen immer noch beträchtlichen
Kindersterblichkeit z. B. sind sie von der höchsten Bedeutung; das wird
jeder Arzt ohne Weiteres zugeben. Die intelligenten, aufmerksamen,
fleissigen, vorbedachten und liebevollen Eltern werden ihre Kinder viel
eher durchbringen und so ihre Eigenschaften häufiger vererben können.
Überhaupt sind die obigen Tugenden im Gesammtkampf der Familien in der
mannig- fachsten Art eine grosse Hülfe. Besonders Altruismus bei allen
Arten von Noth und Krankheit unter den Familien- mitgliedern, wo man
giebt und vergilt, wird durch den Kampf um’s Dasein ebenso gezüchtet
werden, wie früher durch den Kampf grösserer Gesellschaften, der sich
durch den Fortfall der Kriege ja sehr mildern würde. Selbst im
Extralkampf werden verschiedene wirthschaftliche Tugenden, wie
Intelligenz, Energie etc. weiter gezüchtet werden, da sie bei groben
Gefahren sowie im Kampf gegen Krankheiten den ausjätenden Kräften
entgegenarbeiten. Hauptsächlich aber würden, wie Wallace gezeigt hat,
sämmtliche wirthschaftliche Tugenden ausser dem Egoismus, durch die
Fortdauer der geschlechtlichen Auslese weiter gezüchtet werden, weil
die allgemeine Richtung der sexuellen Wahl auf die Tüchtigkeit
überhaupt geht. Wir überzeugen uns also, dass es auch in
socialistischen Gemeinwesen immer noch auslesende Factoren geben wird,
welche die Tendenz haben, die von der Concurrenz-Wirth- schaft
gezüchteten, so nothwendigen Eigenschaften ausser dem Egoismus weiter
zu präserviren. Dazu kommt, dass dem Socialismus die Aufhebung fast
aller der contra- und nonselectorischen Schädlichkeiten gutgeschrieben
werden müsste, die der Capitalismus mit sich gebracht hat, und die ja
nicht nur die Gesundheit und das Leben von Individuen, sondern daneben
oft die von ihnen produzirten Keime treffen und damit häufig auch eine
Verschlechterung der Anlagen der Kinder bedingen, die daraus
hervorgehen. Der Socialismus würde also direct zur Verbesserung von
Devarianten beitragen, würde sich aber doch immer noch dem Rest
schlechter Devarianten gegenüber sehen, der aus anderen Ursachen
entsteht. Ausserdem muss daran festgehalten werden, dass sich der
Haupttheil der Ausjätung thatsächlich bisher in wirth- schaftlicher
Form abgespielt hat, dass der noch bleibende Rest relativ nur gering
ist, und dass er in Anbetracht seiner stetigen Verminderung durch
Individual-Hygiene und Medicin nicht genügt, das drohende Schicksal der
Entartung zu wenden. Erst eine umfangreiche Erzeugung tüchtigerer
Nachkommen durch directe Bewirkung guter Keimesanlagen und ihrer
künstlichen Auslese kann weitere und dauernde Garantien geben.
Principiell ist hier kein Hinderniss zu sehen. Es hängt alles davon ab,
wie wir uns den Entwicklungsgang der Naturwissenschaft vorstellen.
Dieser Entwicklungsgang ist im letzten Jahrhundert ein unerhört
glänzender gewesen, besonders die verbesserten chemischen und
mikroskopischen Methoden haben zahlreiche neue Erkenntnisse zu Tage
gefördert. Auch eine Hygiene der Fortpflanzung kann nur mit
chemisch-physikalischen Zusammenhängen rechnen, und wo diese in ihrer
strengen Folge nicht dargelegt werden können, sind die gröberen, rein
empirisch durch Beobachtung und Experiment festgestellten
Abhängigkeiten immer noch von unschätzbarem Werth. Die Methoden
unterscheiden sich in nichts von denen der Naturwissen- schaft
überhaupt, so dass wir nicht daran zweifeln dürfen, die Gesetze der
Variabilität allmählich soweit unter unsere Herrschaft zu zwingen, dass
Noth und Elend unter den Menschen bis auf geringe Reste verschwinden
können. Haeckel hat einst in einem berühmten Streit ein muthiges Wort
gesprochen, das wohl manchem der da- maligen jungen Studenten noch
heute nachklingt: Impavidi progrediamur! Auch wir wollen fest daran
halten und unentwegt auf den Fortschritt der Wissenschaft bauen.
Berichtigungen: Seite 31 Zeile 7 von oben statt anderen lies
verwandten. „ 47 „ 1 „ unten „ besseren lies gleichen. „ 49 „ 9 „ oben
„ zwischen lies auf. „ 49 „ 9 „ „ „ niedrigen lies niedrigeren. „ 49 „
12 „ „ „ der Elemente lies der biologischen Elemente. „ 72 „ 13 „ unten
„ Ttaate lies Staate. „ 135 „ 2 „ oben „ sämmtliche lies sämmtlichen. „
139 „ 5 „ unten „ Der lies „Der. DRUCK VON MAX SCHMERSOW VORM. ZAHN
& BAENDEL, KIRCHHAIN N.-L. R. Boll’s Buchdruckerei, PERLIN NW.,
Mittel-Strasse 29.
+++
Links
リンク
文献
その他の情報

